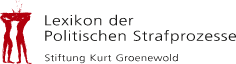Deutschland 1945–1946
Verbrechen gegen den Frieden
Kriegsverbrechen
Verbrechen gegen die Menschlichkeit
Der internationale Militärgerichtshof gegen Hermann Göring u.a.
Deutschland 1945/1946
1. Prozessgeschichte/Prozessbedeutung
Schon zu Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde die politische und militärische Führung Deutschlands schwerster Verbrechen beschuldigt. An einer institutionellen Strafverfolgung hatten die Alliierten zunächst allerdings nur geringes Interesse. Das Desaster ihrer Kriegsverbrecherpolitik nach dem Ersten Weltkrieg wirkte nach. Schwierigste strafrechtspolitische Fragen mussten zuvor entschieden werden. Und das Ende des Krieges war noch gar nicht absehbar: Welche Personen sollten, welche konnten später überhaupt angeklagt werden? Auf welche völkerstrafrechtlichen Tatbestände wollte man die Anklage beziehen? Auf welche Beweismittel die Urteile stützen? Wer sollten die Ankläger, wer die Richter sein? Die wichtigste Frage war deshalb zunächst die: Sollte man angesichts des Ausmaßes der Gewaltverbrechen Deutschlands kurzen Prozess machen mit den Beschuldigten? Oder war es für die Aufklärung der Deutschen und auch für das Rechtsempfinden der Weltöffentlichkeit und die Fortentwicklung des Völkerstrafrechts klüger und politisch weitsichtiger, die Hauptschuldigen vor ein internationales Strafgericht zu stellen, so umstritten dessen Legitimation auch sein mochte?
Als treibende Kraft erwiesen sich seit Kriegsbeginn die in London ansässigen Exilregierungen. Zumal sie sich nicht mit der politisch kontroversen Frage nach dem Umgang mit den Hauptkriegsverbrechern auseinandersetzen mussten, sondern mit dem Gesamtkomplex der Gewaltverbrechen selbst. So begannen sie früh, Nachrichten und Informationen aus ihren Ländern zu sammeln, über Deportationen, Zwangsverpflichtungen, Massenvernichtungen und andere Gewaltverbrechen. Aus diesen Aktivitäten ging Anfang 1942 die Inter-Alliierte Kommission (St. James‘ Declaration) hervor; an ihr beteiligten sich zunächst die Repräsentanten von neun Ländern. Wenig später wurde sie auf Initiative der USA und Großbritanniens erweitert und umbenannt in: United Nations Commission for the Investigation of War Crimes (UNWCC). Sie war allerdings eine politisch eher schwache Einrichtung; ihre Mitglieder verfügten als Regierungsvertreter im Exil nur über eine befristete Legitimation. (Delbrück/Wolfrum 2002, 1027ff.; Taylor 1994, 42ff.)
Die Sowjetunion beteiligte sich nicht. Sie richtete eine eigene staatliche Kommission ein zur Verfolgung von „Verbrechen der deutschen faschistischen Eindringlinge“. Die Prozesse in Krasnodar im Juli und in Charkov im Dezember 1943 waren die ersten Verfahren. Sie sollten vor allem demonstrieren, dass die Sowjetunion rechtsstaatlichen Standards entsprach. Die weder beweis- noch urteilsoffenen Verfahren konnten allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie in der Nachfolge der Schauprozesse Stalins aus den 1930er Jahre standen. (Hilger 2006)
Churchill war diesbezüglich zwar ehrlicher als Stalin; in seiner Skrupellosigkeit gegenüber Deutschland unterschied er sich allerdings nicht von ihm und erklärte die NS-Führung umstandslos zu einer „Bande von Rechtlosen“ (outlaws). Er verweigerte ihnen ein rechtsstaatliches Gerichtsverfahren und wollte bis zu 100 Hauptkriegsverbrecher aus Deutschland, Japan und Italien nach Identitätsüberprüfung exekutieren lassen; vergeblich. Ihm gelang aber, durch die Erklärung der Moskauer Außenministerkonferenz vom 1. November 1943, sich mit seiner Forderung durchzusetzen, dass diejenigen Hauptkriegsverbrecher, deren Verantwortung nicht auf ein geographisch begrenztes Territorium beschränkt war, sondern länderübergreifenden Charakter hatte, von den Alliierten gemeinsam abgeurteilt werden sollten. Das Deutsche Reich wurde informiert.
Roosevelt interessierte sich anfangs nur wenig für diese Fragen. Der Streit zwischen Finanzminister Henry M. Morgenthau und Kriegsminister Henry L. Stimson um die politische Nachkriegsordnung in Deutschland zwang ihn aber, sich zu positionieren. Auf den beiden Konferenzen in Quebec im September 1944 fanden Churchill und Roosevelt im Konzept eines „harten Friedens“ ihre anfangs gemeinsame Basis. Sie folgten den Vorschlägen des Morgenthau-Plans (Program to Prevent Germany from Starting a World War III), der eine Deindustrialisierung und Demilitarisierung vorsah, und übernahmen auch den britischen Vorschlag für eine „Hinrichtung der Erzverbrecher im Schnellverfahren“. (Taylor 1994, 49ff.; Smith 1981, bes. 12ff.)
Kriegsminister Stimson intervenierte. Entschieden verwarf er den Morgenthau-Plan als „Verbrechen gegen die Zivilisation“ und plädierte dafür, dass die USA zusammen mit den anderen Alliierten die Nazi-Hauptkriegsverbrecher vor ein internationales Gericht stellen sollten. Der Streit geriet in die Öffentlichkeit und wurde im Wahlkampf für den 79. Kongress kontrovers aufgenommen. Die Demokraten konnten ihre Mehrheit ausbauen, und Roosevelt gewann zum vierten Mal die Präsidentschaft. Er übernahm nun die Position seines Kriegsministers und stärkte damit auch die Stellung von Stimsons führenden Juristen – zum Vorteil für das kommende Verfahren.
Mitte September legte Oberst Murray Bernays ein wegweisendes Memorandum vor, das Lösungsansätze für zwei schwierige gerichtliche Probleme enthielt. Bernays, im Zivilberuf Anwalt in New York, hatte mit der American Jewish Conference und dem War Refugee Board zusammengearbeitet. Er war mit der Neuartigkeit der Nazi-Verbrechen bereits vertraut, sowohl mit den Gräueltaten an russischen Kriegsgefangenen als auch mit den Verbrechen an deutschen Juden in der Vorkriegszeit. Um diese Straftaten in die Kriegsverbrechen einbeziehen zu können, nutzte er das in der angloamerikanischen Rechtsprechung verankerte Vergehen der kriminellen Verschwörung. Und angesichts des quantitativen Umfangs der Gewaltverbrechen und der nicht überschaubaren Anzahl von Tätern schlug er vor, die bloße Mitgliedschaft in nachgewiesen kriminellen NS-Organisationen zu einem Straftatbestand zu erheben.
Die Bedenken waren groß, die Einwände zahlreich, aber bessere Vorschläge gab es nicht. Sie fanden die Zustimmung von John J. McCloy, dem stellvertretenden US-Kriegsminister und späteren Hohen Kommissar in der frühen Bundesrepublik. Auf Veranlassung des Präsidenten kam ein weiteres neues Verbrechen hinzu, der „Angriffskrieg“. Auf dieses weitgehend vom Kriegsministerium entwickelte Anklagekonzept sollte sich Roosevelt auf der Konferenz von Jalta Anfang Februar 1945 stützen. Dort standen allerdings Fragen der politischen Neuordnung Europas nach dem Kriege im Mittelpunkt. Zur gleichen Zeit konferierten in San Francisco die Außenminister Eden, Molotow und Stettinius über die Charta der Vereinten Nationen. Sie nutzten diese Gelegenheit, über das Stimson-Memorandum zu beraten und ihm durch ihre Juristen eine definitive Form zu geben. (Smith 1982, 117ff.)
Ihre Bemühungen waren noch nicht abgeschlossen, als Roosevelt starb und sein Nachfolger Harry S. Truman in das Verfahren durch eine nachhaltige personalpolitische Entscheidung eingriff. Am 2. Mai 1945 ernannte er Robert H. Jackson zum Vertreter der USA und Chefankläger; er sollte vor einem internationalen Militärgericht den Führern der europäischen Achsenmächte den Prozess machen. Jackson war 1939 von Roosevelt zum Attorney General ernannt worden (in den USA sind in diesem Amt der Oberste Bundesanwalt und der Justizminister vereint) und wurde wenig später Richter am Supreme Court. Angestoßen hatten diese Initiative offenbar die einflussreichen Juristen um Kriegsminister Stimson, John McCloy und Samuel Rosenman, Roosevelts langjähriger Rechtsberater und Redenschreiber. Diese waren es denn auch, die zusammen mit Außenminister Stettinius einen Tag später der in San Francisco tagenden Gründungsversammlung für die Vereinten Nationen und insbesondere den Außenministern Eden und Molotow den amerikanischen Anklageplan samt Person des Chefanklägers vorstellten. Der Brite stimmte sofort zu, der Russe zögerte und sah sich – so kurzfristig – überfordert.
Es war wohl ein Zufall, dass die Unterzeichnung der UN-Charta durch die 50 Gründerstaaten am 26. Juni 1945 in San Francisco und der Konsens für ein internationales Militärtribunal zur Verfolgung der NS-Verbrechen Hand in Hand gingen. Jedenfalls begannen an diesem Tag in London die Beratungen über die prozessrechtlichen Grundlagen für das Tribunal. Aber es war eine für den Geist und den politischen Willen jener Tage doch bezeichnende Koinzidenz, zumal nach zwei Weltkriegen.
Die operative Grundlage wurde am 8. August mit dem Londoner Viermächte-Abkommen beschlossen, auch „Londoner“ oder „Nürnberger Charta“‘ genannt. Sie umfasste die Prozessordnung für das Hauptverfahren, die zwölf Nachfolgeprozesse durch die US-amerikanische Justiz und den Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher von Tokio. Zudem definierte sie in Art. 6 der IMT-Charta die drei bzw. vier völkerstrafrechtlichen Tatbestände: „Verbrechen gegen den Frieden“ (6a) (II), „Kriegsverbrechen“ (6b) (III) und „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ (6c) (IV). Zwei dieser Komplexe, 6a und 6c, waren bisher im Völkerstrafrecht nicht kodifiziert. Entsprechend kontrovers gestaltete sich ihre Definition. Mit der neuen Straftat „Verbrechen gegen den Frieden“ wurde die „Verschwörung und Vorbereitung eines Angriffskrieges“ (I) eingeführt und zugleich der Weg fortgesetzt, den man mit der Eingrenzung des Krieges nach dem Ersten Weltkrieg eingeschlagen hatte. Die drei alliierten Ankläger in Nürnberg machten diese Straftaten zu den Anklagepunkten I–IV. (Delbrück/Wolfrum 2002, 1028; Ahlbrecht 1999, 71ff.)
Und nicht zuletzt bestätigte man im Anschluss an die Erklärung der Drei-Mächte-Konferenz im Oktober 1943 in Moskau, dass das Gericht nur gegen jene Täter Anklage erheben sollte, deren Verantwortung nicht auf einen bestimmten geographischen Raum zu begrenzen war. Die Charta gilt als „Geburtsurkunde des Völkerstrafrechts“ (Werle 2003, 8). Sie bildete die Grundlage für das Kontrollratsgesetz Nr. 10 und war maßgeblich auch für die Nachfolgeprozesse. Große Schwierigkeiten bereitete den Alliierten der Straftatbestand des „Angriffskrieges“. Er sollte in einem universellen, modernen Völkerstrafrecht besonders herausgestellt werden. Deshalb trennte Jackson diesen Anklagepunkt von der Klausel der Achsenmächte und nahm sie in den Einleitungsabsatz von Art. 6 auf. „Angriffskrieg“ hatte damit den gleichen, allgemeinen Status wie „Kriegsverbrechen“ und „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“.
Als besonders schwierig erwies sich die Auswahl der Angeklagten. Hitler und Himmler, Goebbels und Heydrich waren tot. Die Briten hätten sich mit ihnen begnügt, zumal sie wegen ihrer großen Skepsis gegenüber einem Prozess die Zahl der Angeklagten begrenzen wollten. Die Amerikaner, Franzosen und Russen forderten, Militär- und Wirtschaftsführer einzubeziehen. Die Londoner Konferenz musste auch über den Gerichtsort entscheiden. Die Sowjetunion wünschte Berlin, wo sich der Sitz des Alliierten Kontrollrats befand. So wurde der Prozess am 18. Oktober 1945 im Plenarsaal des Berliner Kammergerichtes eröffnet. Bei der Entscheidung über den Ort des gesamten Verfahrens setzten sich allerdings die USA durch. Nürnberg lag in ihrer Besatzungszone, verfügte mit dem Justizpalast und dem großen Gefängnis über zwei weitgehend intakte und geeignete Gebäude. Als ehemalige „Stadt der Reichsparteitage“ hatte Nürnberg einen hohen symbolpolitischen Wert. Weshalb die USA dort auch in den zwölf Nachfolgeprozessen Anklage erhoben gegen namhafte Vertreter div. Führungsgruppen Deutschlands. Schließlich trugen sie den weitaus größten Anteil an den Lasten und Kosten des Verfahrens.
2. Personen
| Die Angeklagten | Die Verteidiger |
|---|---|
| Göring, Hermann (1883–1946), SA/NSDAP 1923/1927, 1932 Wahl zum Reichstagspräsident, Ministerpräsident Preußen, Reichskommissar für den Luftverkehr 1935–45, Oberbefehlshaber der Luftwaffe | Dr. Otto Franz Walter Stahmer |
| Heß, Rudolf (1894–1987), NSDAP 1920, Stellvertreter Hitlers in der Partei, Mai 1941 Flug nach Großbritannien | Dr. Alfred Seidl |
| Ribbentrop, Joachim von (1893–1946) NSDAP 1932, Reichsaußenminister 1938–45 | Dr. Bernhard Otto Martin Horn Dr. Fritz Sauter |
| Rosenberg, Alfred (1893–1946), NSDAP 1923 Reichsleiter NSDAP für Weltanschauung und Außenpolitik, Herausgeber des Völkischen Beobachters, Leiter des Reichsministeriums für die besetzen Ostgebiete | Dr. Alfred Thoma |
| Frick, Wilhelm, Dr. (1877–1946), Jurist, Hitlerputsch, seit 1924 Mitglied des Reichstags, NSDAP 1925, Thüringischer Minister für Inneres 1930, Reichsminister des Innern 1933–43, Reichsprotektor für Böhmen-Mähren | Dr. Otto Pannenbecker |
| Funk, Walter, Dr. (1890–1960) Jurist/Journalist, Staatssekretär im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda 1933, Reichsminister für Wirtschaft und Reichsbankpräsident 1938/39 | Dr. Fritz Sauter |
| Schacht, Hjalmar, Dr. (1877–1970), Volkswirt, 1923–30/1933–39 Reichsbankpräsident, 1934–37 Reichswirtschaftsminister, Freispruch, Spruchkammer: acht Jahre Arbeitslager, 1948 entlassen | Dr. Rudolf Dix |
| Dönitz, Karl (1891–1980), Großadmiral, 1936 Oberbefehlshaber U‑Boote, 1943 Kriegsmarine, Chef der Reichsregierung, Kapitulation | Flottenrichter Otto Kranzbühler |
| Raeder, Erich (1876–1960), Großadmiral, 1928–35 Chef der Marineleitung, 1935–43 Oberbefehlshaber der Kriegsmarine | Dr. Walter Siemers |
| Keitel, Wilhelm (1882–1946), Generalfeldmarschall, 1935–38 Chef des Wehrmachtsamt im Reichskriegsministerium, 1938–45 Leiter des Oberkommandos der Wehrmacht | Dr. Otto Nolte |
| Jodl, Alfred (1890–1946), Heeresoffizier, ab 1944 Generaloberst und Chef des Wehrmachtsführungsstabes im Oberkommando der Wehrmacht | Prof. Dr. Franz Exner Prof. Dr. Hermann Jahrreiß |
| Kaltenbrunner, Ernst, Dr. (1903–1946) Jurist, österreichischer Heimatschutz, NSDAP und SS 1930/31, Leiter der österr. SS und Polizei 1938, Leiter des Reichsicherheitshauptamtes 1943 | Dr. Kurt Kauffmann |
| Frank, Hans, Dr. (1900–1946), Jurist, Mitglied DAP/NSDAP 1919, RA Hitlers, Generalgouverneur im nicht annektierten Restpolen, Suizidversuche 1945 | Dr. Alfred Seidl |
| Streicher, Julius (1885–1946), 1921 NSDAP, 1923 Gründer des Stürmer, 1940 wegen Korruption aller Parteiämter enthoben | Dr. Hanns Marx |
| Schirach, Baldur von (1907–1974), 1925 NSDAP, 1928 Leiter des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes, 1931 Reichsjugendführer NSDAP, bis 1940 Gauleiter/Reichsstatthalter Wien | Dr. Fritz Sauter |
| Sauckel, Fritz (1894–1946), Hilfsarbeiter, 1923 NSDAP, Gauleiter Thüringen, 1942–45 Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz (Zwangsarbeiter) | Dr. Robert Servatius |
| Papen, Franz v. (1879–1969), Offizier/Politiker/Diplomat (Zentrum; NSDAP), 1932 Reichskanzler, Vizekanzler unter Hitler, 1934 entmachtet, ab 1939 Botschafter in Ankara | Dr. Egon Kubuschok |
| Seyß-Inquart, Arthur, Dr. (1892–1946), Jurist, österr. Politiker, 1938 Reichsstatthalter Ostmark, 1940–45 Reichskommissar für die besetzten Niederlande | Dr. Gustav Steinbauer |
| Speer, Albert (1905–1981), Architekt, NSDAP 1931, Hitlers Baumeister, 1942 Reichsminister für Rüstung und Munition | Dr. Hans Flächsner |
| Neurath, Konstantin Frhr. von (1873–1956), Diplomat, 1932–38 Reichsminister für Äußeres, 1939 Reichsprotektor in Böhmen-Mähren, 1941 beurlaubt | Dr. Otto Wilhelm Freiherr von Lüdinghausen-Wolff |
| Fritzsche, Hans (1900–1953), NSDAP 1933, Abteilungsleiter Rundfunk im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda | Dr. Heinz Fritz |
| Bormann, Martin (1900–1945), Chef der NSDAP-Kanzlei, angeklagt in absentia | Dr. Friedrich Bergold |
| Ley, Robert, Dr. (1890–1945), Jurist, Chef der Deutschen Arbeitsfront, Suizid 25.10.1945 | |
| Krupp von Bohlen und Halbach, Gustav (1870–1950), verhandlungsunfähig, an seiner Stelle wurde Sohn Alfried angeklagt. | Dr. Walter Ballas |

Die Verteidiger der 20 Angeklagten, 13. November 1945,
Fotograf unbekannt, © picture alliance / akg-images
| Die Chefankläger und ihre Stellvertreter | Die Richter |
|---|---|
| USA Robert H. Jackson (1892–1954) Attorney General, Richter am Supreme Court Oberst Robert G. Storey Thomas D. Dodd | USA Francis Beverley Biddle (1886–1968) Anwalt, Richter, Attorney General (Demokratische Partei) John Johnston Parker (1885–1958) Stellv., Anwalt, Richter, Politiker (Republikanische Partei) |
| UdSSR Roman Rudenko (1907–1981) Generalstaatsanwalt Oberst J.W. Pokowsky | UdSSR Iona Nikitchenko (1895–1967) Richter bei den Moskauer Schauprozessen Alexander Wolchkow (1902–1978) Stellv., Jurist, Oberstleutnant |
| Großbritannien Sir Hartley Shawcross (1902–2003), Abg. (Labour), Kronanwalt, Attorney General (Kabinett Attlee) Sir David Maxwell-Fyfe | Großbritannien Lordrichter Geoffrey Lawrence (1880–1971) Präsident des IMT, Lord Justice of Appeal Norman Birkett (1883–1962), Stellv., Liberaler Abgeordneter, Kronanwalt, Richter |
| Frankreich Francois de Menthon (1900–1984), Präsident der katholischen Arbeiterjugend Professor für Arbeitsrecht, Résistance, Abgeordneter (MRP), Justizminister Auguste Champetier de Ribes, Charles Dubost Edgar Faure | Frankreich Henri Donnedieu de Vabres (1880–1952) Strafrechtsprofessor in Paris Robert Falco (1882–1960) Staatsanwalt, Richter, Generalanwalt des Appellationsgerichts Paris |
3. Zeitgeschichtliche Einordnung
Mit der sprunghaften Weiterentwicklung der Kriegswaffen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatten sich auch die Bewertungen und Einstellungen zum Krieg und zu den Kampfhandlungen geändert. Die Einsicht setzte sich durch, dass für das Kampfgeschehen Regeln vereinbart werden müssten. In den Haager Konventionen von 1899 und 1907 (der sog. Landkriegsordnung) war festgelegt, angesichts der tendenziellen Entgrenzung des Krieges Begrenzungen durch spezifische Kennzeichnungen einzuführen. Zukünftig sollte der Kombattantenstatus eindeutig erkennbar sein, die Zivilbevölkerung dadurch besser geschützt, und die Behandlung von Kriegsgefangenen ebenso an bestimmte Normen gebunden werden wie das Verhalten der Besatzungstruppen.
Das Geschehen des Ersten Weltkrieges konfrontierte die Kriegsparteien mit einer ganz neuen Problematik. Die Eindämmung der Kriegsfurie durch die Haager Konventionen hatte versagt. Nun stand man vor dem sehr viel umfassenderen Problem, Kriegsgefahr und Kriegsverbrechen (insbes. Misshandlung und Tötung von Zivilisten, gefangenen und verwundeten Soldaten) selbst zu begrenzen, zunächst durch Ermittlung der Kriegsschuld und Anklage der Schuldigen; später dann auch durch Ächtung des Krieges in völkerrechtlichen Verträgen (Briand-Kellog-Pakt 1928).
In Art. 227 und 228 des Versailler Vertrages (VV) hatten die Alliierten das Deutsche Reich dazu verpflichtet, Kaiser Wilhelm II. und führende Militärs auszuliefern; fast 900 Personen sollten vor Gericht gestellt werden. Der Verweigerungsprotest in der Bevölkerung aber war so groß, dass sich die deutsche Regierung nicht in der Lage sah, das Auslieferungsverlangen zu erfüllen. Die Siegermächte mussten nachgeben und den deutschen Vorschlag akzeptieren, die Beschuldigten vor dem Reichsgericht in Leipzig selbst anzuklagen und abzuurteilen. Die Alliierten verzichteten aber nicht auf den Vorbehalt, ggf. ihren friedensvertraglichen Rechten Geltung zu verschaffen. Zwar wurden bis Ende der 1920er Jahre in Hunderten von Fällen gegen „Kriegsbeschuldigte“ (so der zeittypisch beschönigende Terminus) ermittelt. Aber nur in einem geringen Bruchteil auch Freiheitsstrafen verhängt; die meisten Verfahren endeten durch gerichtlichen Einstellungsbeschluss. Das Fazit einer grundlegenden, umfassenden Untersuchung dieser Prozesse erklärt bündig, warum das Leipziger Reichsgericht das IMT Nürnberg nicht vorwegnehmen konnte; entweder es gibt nach staatlichen Gewaltverbrechen „einen Regimewechsel, deutlich genug, damit sich die neue Regierung an die juristische Aufarbeitung machen kann, oder eine internationale Strafgerichtsbarkeit wird aktiv […].“ (Hankel 2003, 523)
Die Bestrafung Deutschlands durch die Alliierten, die es in Art. 231 des VV zum Alleinschuldigen erklärten und für alle Verluste und Zerstörungen verantwortlich machten, hatte ungleich schwerwiegendere Folgen. Der von keinem Gericht, keiner mehr oder minder unabhängigen Expertenkommission erhärtete Schuldvorwurf wurde von der deutschen Bevölkerung nicht nur mehrheitlich als „Kriegsschuldlüge“ zurückgewiesen; schlimmer noch, sie benutzte dieses verhängnisvolle Diktum zur Selbsttraumatisierung. Der junge SPD-Reichstagsabgeordnete Carlo Mierendorff sprach später von der „einzigartigen Autosuggestion eines ganzen Volkes“ (zit. Heinemann 1987, 383) Die nationale Rechte nutzte das politische Gift dieser kollektiven Kränkung nach Kräften. Gleichwohl, dank der auf Versöhnung und europäische Befriedung zielenden Außenpolitik Gustav Stresemanns (DVP) und Hermann Müllers (SPD), war Anfang der 1930er Jahre der Weg einer abschließenden Reparationsregelung (Young-Plan) und absehbaren Revision des Versailler Vertrages schon mehrheitsfähig. Aber damit mochte sich ein Großteil der Deutschen nicht zufriedengeben. Man verlangte nach Satisfaktion für den 1914/18 verspielten Versuch Deutschlands, Weltmacht zu werden – und scheiterte abermals.
Nachdem der Führerstaat gewaltsam etabliert war, entstand ein duales Herrschaftssystem. Es beruhte auf überkommenen, rechtsstaatlichen Normen einerseits und auf führerstaatlichen Maßnahmen andererseits, auf Treue und Täuschung also. Mochte Hitler auch seine friedenspolitischen Absichten beteuern, Zweck seiner Herrschaft war der Krieg. Damit konnten sich Wut und Größenwahn eines gekränkten deutschen Herrenmenschentums und seiner verblendeten Führung sechs Jahre lang austoben. Einem rassen- und raumpolitisch definierten und planvoll organisierten Vernichtungsweltkrieg mit Verbrechen und Verwüstungen, denen in der menschheitlichen Kriegsgeschichte Vergleichbares nicht gegenübersteht, fielen auf beiden Seiten etwa 55 Mio. Menschen zum Opfer (davon etwa 25 Mio. Zivilisten). Danach musste man alles von den Siegern befürchten, nur eines schien ausgeschlossen, dass Deutschland schnell wieder aufsteigen würde. Und doch gelang dies, zumindest in den drei westlichen Besatzungszonen: Marschallplan, Wirtschaftswunder und Neuaufbau, eingebettet in eine supranationale Wirtschaftsgemeinschaft, verwandelten Westdeutschland in nur zehn Jahren erneut in eine moderne Industrielandschaft.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das erst 1871 gegründete Deutsche Kaiserreich, zu einer der führenden Wirtschafts‑, Industrie‑, Wissenschafts- und Kulturnationen aufgestiegen. Danach hat es diesen Status innerhalb von nur einer Generation verspielt und schien dauerhaft unfähig, sich in die zivilisierte Staatengemeinschaft einzufügen. Nach zwei Weltkriegen mit Völkermord und Zerstörungen unvergleichbaren Ausmaßes, wurde es als der größte Verbrecherstaat von der Weltöffentlichkeit geächtet. Damals konnte niemand auch nur ahnen, dass nach der Vereinigung der beiden deutschen Teilstaaten, also am Ende desselben Jahrhunderts, dieses Deutschland als der eigentliche Gewinner der so extrem ungleichen Jahrhunderthälften dastehen würde, von der Welt erneut bewundert und beneidet, aber in Teilen auch mit Misstrauen beobachtet, wenn nicht insgeheim gefürchtet und gehasst, was in der eher passiven Militär- und Interventionspolitik des Natomitgliedes bis heute nachwirkt.
4. Anklage
Dieses schon 1945 nur schwer verständliche, widerspruchsvolle Deutschlandbild vor Augen, hielt Chefankläger Robert H. Jackson am 21. November seine längst legendäre Eröffnungsrede. Sie war – zusammen mit seiner, für das analytische Verständnis des Führerstaates noch bedeutsameren Schlussrede am 26. Juli 1946 – der unvergessliche Höhepunkt des Prozesses. Jackson sprach als Ankläger und Richter zugleich. Seine Rede ist vielfach abgedruckt und übersetzt worden. Ihre rechtsstaatlichen Kernsätze könnten als Präambel des Grundgesetzes den bleibenden Sinn unserer Verfassung dauerhaft zum Ausdruck bringen.
„Die Untaten, die wir zu verurteilen und zu bestrafen suchen“, begann Jackson, „waren so ausgeklügelt, so böse und von so verwüstender Wirkung, dass die menschliche Zivilisation es nicht dulden kann, sie unbeachtet zu lassen […]. Dass vier große Nationen, erfüllt von ihrem Siege und schmerzlich gepeinigt von dem geschehenen Unrecht, nicht Rache üben, sondern ihre gefangenen Feinde freiwillig dem Richterspruch des Gesetzes übergeben, ist eines der bedeutendsten Zugeständnisse, das die Macht jemals der Vernunft eingeräumt hat.“ (Jackson 1946, 9)
Gleichwohl war es für das Internationale Nürnberger Militärtribunal schwer, nicht ins Zwielicht der Siegerjustiz zu geraten. Natürlich zogen die Verteidiger und ihre Mandanten die Legitimität des Gerichtes in Zweifel und warfen dem Militärtribunal vor, das Rückwirkungsverbot ebenso zu verletzen wie den tu quoque (du auch)-Grundsatz. Für die Opfer war es unerträglich, dass nicht alle Beschuldigten auch verurteilt wurden. Freispruch konnte es doch im Schatten von Auschwitz nicht geben! Doch auch in diesem Gericht musste der Grundsatz gelten in dubio pro reo.
Jackson ging in seiner Rede auch darauf ein. Ausdrücklich betonte er die „Schwächen eines Gerichtsverfahrens“, bei dem sich nicht auch jene Staaten verantworten müssten, „die jetzt hier zu Gericht sitzen“. Dieser Prozess sei „der verzweifelte Versuch der Menschheit, die Strenge des Gesetzes auf die Staatsmänner anzuwenden, die ihre Macht […] benutzt haben, die Grundlagen des Weltfriedens anzugreifen […].“ Deshalb stünden ausgewählte deutsche Hauptkriegsverbrecher vor Gericht. „Ihre Taten haben die Welt in Blut getaucht und die Zivilisation um ein Jahrhundert zurückgeworfen. Sie haben ihre Nachbarn in Europa dem Frevel und der Folterung, der Plünderung und dem Raub preisgegeben, wie nur Anmaßung, Grausamkeit und Gier sie ersinnen konnten. Sie haben das deutsche Volk auf die tiefste Stufe des Elends geworfen, von dem frei zu werden es so bald nicht hoffen kann. In jedem Erdteil haben sie Hass aufgerührt und im Innern zur Gewalttat aufgestachelt. Zusammen mit den Gefangenen dort auf der Anklagebank stehen auch alle diese Taten hier vor Gericht.“ (Jackson 1946, 68f.)
Knapp, entschieden und nicht ohne bittere Ironie wies Jackson den wiederholten Vorwurf der Verteidigung zurück, dass das Internationale Militärtribunal mit den neuen Straftatbeständen des Londoner Statuts den bewährten rechtsstaatlichen Grundsatz des Rückwirkungsverbots verletzten würde nullum crimen nulla poena sine lege (kein Verbrechen, keine Strafe ohne Gesetz)
Was dem Gericht als objektiver Fehler angelastet werden sollte, konnte dieses als Wissenslücke und bloße Schutzbehauptung entlarven. Gegen die Kritik am vorgeblich neuen Straftatbestand des Angriffskrieges wies Jackson Verteidiger und Angeklagte darauf hin, dass sich Deutschland, Italien und Japan mit fast allen Staaten der Welt im Briand-Kellog-Pakt von 1928 verpflichtet hatte, auf den Krieg als Mittel der Politik zu verzichten. Und schon ein Jahr zuvor habe Deutschland im Völkerbund zusammen mit 48 Mitgliedsstaaten beschlossen, dass der „Angriffskrieg ein internationales Verbrechen gegen das Menschengeschlecht darstellt“. Auch den erwarteten Versuch der Verteidigung, die Angeklagten unter Bezug auf das Rückwirkungsverbot vom Vorwurf zu entlasten, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben, entkräftete Jackson.
Keitel und Jodl seien von amtlichen Rechtsberatern informiert worden, dass die Befehle, russische Kriegsgefangene zu misshandeln und Gefangene der „Kommandotruppen“ erschießen zu lassen, eindeutig völkerrechtswidrig waren. Und nach dem „Gesetz aller zivilisierten Völker“ sei es „natürlich ein Verbrechen“ gewesen, wenn eine Person eine andere mit körperlicher Gewalt angriff; wie sollte es da „vor dem Gesetz eine schuldfreie Handlung“ sein, wenn Millionen durch Erschießung oder Vergasung getötet wurden? Und schließlich nannte Jackson auch die Organisationen verbrecherisch, die für den „inneren Zusammenhang“ zwischen Planung und Ausführung der massenhaften Tötungen verantwortlich waren: das Korps der Politischen Leiter der NSDAP, SA, SS, SD und Gestapo, Reichskabinett, OKW und Generalstab. Diese Organisationen und ihre nach Hunderttausenden zählenden Mitglieder saßen gleichsam als unsichtbarer 25. Angeklagter mit auf der Anklagebank und wurden nicht weniger differenziert beurteilt als die sogenannten Hauptkriegsverbrecher.
Zum Abschluss fand er noch einmal Worte, die den welthistorischen Ort dieses Gerichtes verdeutlichen konnten: „Die Zivilisation erwartet nicht, dass Sie den Krieg unmöglich machen können. Wohl aber erwartet sie, dass ihr Spruch, die Kraft des Völkerrechts mit seinen Vorschriften und seinen Verboten und vor allem mit seiner Sühne und dem Frieden zum Beistand geben werde, so dass Männer und Frauen guten Willens in allen Ländern leben können, keinem untertan und unterm Schutz des Rechts‘.“ (Jackson 1946, 69)
Die Verhandlungen in diesem ad hoc einberufenen, internationalen Militärtribunal, die am 22. November 1945 begannen und am 31. August 1946 abgeschlossen wurden, folgten dem angloamerikanischen Strafprozess, bei dem der Richter nicht Herr des Verfahrens ist. Die beiden Prozessparteien, Ankläger und Verteidiger, bestimmen den Prozessverlauf. So auch in Nürnberg. Das Verfahren stützte sich vor allem auf Dokumente, weniger auf Zeugenaussagen – und in großem Umfang auf eidesstattliche Erklärungen (sog. Affidavits), sofern die Zeugen nicht vor Gericht erscheinen konnten, sowie Bildmaterial (Film und Fotografie), das sich, so später Telford Taylor, im strengen Sinn zumeist nicht als gerichtliches Beweismittel eignete. Wegen der kurzen Vorbereitungszeit standen viele Beweismittel erst während des Verfahrens zur Verfügung, aber oft nicht allen Beteiligten gleichzeitig, was insbesondere die Verteidigung benachteiligte, zumal die Amerikaner englischsprachige Übersetzungen der Dokumente verteilten. Vom „Urkundenkrieg“ zwischen Verteidigung und Anklage war wiederholt die Rede, das „Urkundendurcheinander“ sprichwörtlich. Auch die inhaltliche Transparenz litt darunter. Der Prozess folgte der unter den alliierten Anklägern vereinbarten Arbeitsteilung. Den Anfang machte die anglo-amerikanische Anklage, dann folgten die französischen und sowjetischen Ankläger. Die Amerikaner stellten nicht grundlos den Chefankläger des Prozesses; sie verfügten auch über die umfangreichsten personellen und materiellen Ressourcen. Angesichts dieser Dominanz war es nur folgerichtig, dass die sog. zwölf Nachfolgeprozesse allein in ihrer Hand lagen.
Die Verteidigung klagte indes weiterhin über unzureichende Information und Vorbereitungsmöglichkeiten. Als mangelhaft wurde im Umgang mit dem erdrückend umfangreichen Dokumentenmaterial vor allem Planung und Koordination der Vorlage und des Vortrags kritisiert. (Smith 1979, 94ff.) Bei den schriftlichen Beweisstücken handelte es sich zunächst ausschließlich um englische Übersetzungen. Dagegen protestierten die französischen und russischen Ankläger ebenso wie die deutschen Verteidiger. Die Richter entschieden, dass Beweise in allen vier Gerichtssprachen vorgelegt werden müssten und hatten dafür einen technisch sehr einfachen Vorschlag: Alle schriftlichen Beweise sollten nun verlesen werden, mussten also durch die Simultananlage gehen und lagen damit in englischer, deutscher, französischer und russischer Sprache vor. Nicht bedacht hatte das Gericht, das dieses Verfahren langwierig war und dem Prozess viel von seiner anfänglichen Dramatik nahm. Im Übrigen bemühte sich die Anklage, Verteidigung und Presse durch sog. „Key-Documents“ besser als bisher zu informieren. Dazu gehörten die Aufzeichnungen und Ansprachen Hitlers vor den Spitzen der Wehrmacht, die Reichsverteidigungsgesetze, militärische Befehle und Erlasse usw.; die Aufzeichnungen stammten teilweise von Hitlers Adjutanten Oberst Hoßbach und Major Schmundt. (v.d. Lippe 1951, 34ff.)
Das Gericht bewegte sich also zwangsläufig im Spannungsverhältnis von unvermeidlicher Improvisation und zukunftsweisender Innovation. Immerhin brachte es nicht nur heftig umstrittene völkerstrafrechtliche Neuerungen hervor; auch hinsichtlich der materiellen Beweismittel war es innovativ. Erstmals wurde umfängliches dokumentarisches Film-und Bildmaterial für die Gewaltverbrechen in den Konzentrations- und Vernichtungslagern eingesetzt. Man hatte es bei der SS gefunden und bei der Befreiung der Lager selbst hergestellt. Die Konfrontation mit den visuellen Beweismitteln blieb auch bei den Angeklagten nicht ohne emotionale Wirkung. Für die englisch-amerikanischen Ankläger war sie von größter Bedeutung, konnten sie sich doch nicht auf Gewaltverbrechen der Deutschen in ihren eigenen Ländern berufen.
Am 29. November wurde der von den US-Truppen gefundene Film über die Konzentrationslager gezeigt. Allerdings geschah dies wiederum zu einem nicht ohne weiteres einsichtigen Zeitpunkt; das Gericht beschäftigte sich, wenige Tage nach Beginn des Verfahrens, noch gar nicht mit dem Thema. Aber hinter dem Versehen stand wohl eine Absicht. Und die Angeklagten zeigten Wirkung. Aufschluss darüber gibt eine selten eindringliche Quelle.
Im Telegrammstil hat der US-amerikanische Gerichtspsychologe Gustave M. Gilbert erste, spontane Reaktionen in seinem Tagebuch festgehalten. Von seinen Beobachtungen während der Filmvorführung heißt es: „Schacht protestiert, Film ansehen zu müssen […] Keitel setzt Kopfhörer auf, starrt aus Augenwinkeln auf Leinwand […] Neurath hat Kopf gesenkt, schaut nicht hin […] Funk bedeckt Augen, scheint Qualen auszustehen, schüttelt den Kopf […] Ribbentrop schließt die Augen, blickt weg, Sauckel wischt sich Stirn ab, […] Frank schluckt krampfhaft, blinzelt mit Augen, um Tränen zurückzuhalten.“
Am Abend ging Gilbert mit einem amerikanischen Offizier in den Gefängnistrakt, um mit den Angeklagten einzeln in ihren Zellen über den Film zu sprechen. „Fritzsche: Keine Macht des Himmels oder der Erde – wird diese Schande von meinem Land nehmen! – nicht in Generationen, nicht in Jahrhunderten!“ Er drohte die Beherrschung zu verlieren und bat um Verzeihung. Als man ihm Schlaftabletten anbot, lehnte er ab: „Es wäre nur Feigheit, all das mit Betäubungsmitteln aus dem Bewußtsein zu vertreiben!“ […] „Streicher gab ohne jedes erkennbare Gefühl zu, der Film sei ‚schrecklich‘ gewesen, und fragte dann, ob die Posten nachts leiser sein könnten, damit er schlafen könne. Speer zeigte äußerlich keine Gefühlsbewegung, erklärte jedoch, er sei nur noch entschlossener, eine Kollektiv-Verantwortlichkeit der Partei-Führerschaft zu bekennen und das deutsche Volk von der Schuld freizusprechen. Frank war außerordentlich bedrückt und erregt […] ‚Wenn man bedenkt, daß wir wie Könige lebten und an diese Bestie glaubten! – Lassen Sie sich von niemand erzählen, daß sie nichts gewußt hätten! Jeder ahnte, daß etwas ganz und gar nicht in Ordnung war mit diesem System, auch, wenn wir nicht alle Einzelheiten wußten. […] Seyß-Inquart gab zu: ‚Es geht einem an die Nieren. Aber ich halte durch. Dönitz zitterte noch vor Erregung und sagte halb auf Englisch: „Wie können Sie mich beschuldigen, von diesen Dingen etwas gewußt zu haben? […] Sauckel war völlig mit den Nerven am Ende. Es zuckte in seinem Gesicht und er zitterte am ganzen Leibe. Er spreizte die Finger, starrt uns verstört an und rief aus: ‚Erwürgen würde ich mich mit diesen Händen, wenn ich dächte, ich hätte das Geringste mit jenen Morden zu tun gehabt! Es ist eine Schande! […] Keitel: ‚Es ist schrecklich. Wenn ich derartige Dinge sehe, schäme ich mich, ein Deutscher zu sein! – Diese dreckigen SS-Schweine waren es! […] Göring schließlich war sichtlich gekränkt, weil der Film seine ‚Show‘ verdorben hatte. ‚Es war ein so angenehmer Nachmittag, bis man diesen Film zeigte. Mein Telefongespräch über die Österreich-Affäre wurde vorgelesen und alle lachten mit mir darüber. Und dann kam dieser grauenhafte Film und verdarb einfach alles.‘“ (Gilbert 2012, 50ff.) Nachhaltig war diese kurzzeitige emotionale Erregung aber offenbar nicht.
In den ersten Wochen standen die Straftatkomplexe I und II (Angriffskrieg und Kriegsverbrechen) im Mittelpunkt der Verhandlung. Die amerikanischen Ankläger sprachen zunächst zur totalitären Kontrolle von Erziehung, Propaganda, Presse und Wirtschaft, um anschließend über Militarisierung, Aufrüstung, Vertragsbrüche, „Verschwörung“ und Angriffskrieg vorzutragen, also über den „Anschluss“ Österreichs, die Invasion Englands („Seelöwe“) die Angriffskriege gegen die Tschechoslowakei („Fall Grün“), gegen Polen („Fall Weiß“), gegen die Sowjetunion („Barbarossa“), gegen Dänemark und Norwegen („Weserübung“), gegen Holland, Belgien und Luxemburg („Fall Gelb“), gegen Jugoslawien und Griechenland („Marita“).
Mitte Dezember sah das Gericht einen weiteren Film: „Der Naziplan“, eine Collage aus Bildern von den Parteitagen, Hitler-Reden und dem Volksgerichtshof. Mancher unter den Angeklagten war wohl froh, sich noch einmal in Uniform und mit Glanz und Gloria auf Bildern aus „den guten alten Zeiten“ zu sehen. Aber die vergnügte Stimmung verging schnell. Unmittelbar danach folgte der amerikanische Anklagevortrag über Kriegs- und Menschlichkeitsverbrechen, über Deportation, Zwangsarbeit, Judenverfolgung, Konzentrationslager und die „verbrecherischen Organisationen“. Die Anklage stützte sich u.a. auf zwei berüchtigte Beweisstücke: Den in Leder gebundenen 75seitigen Bericht des SS- und Polizeigenerals Jürgen Stroop über die Liquidierung des Warschauer Gettos mit 65 000 bis zuletzt tapfer kämpfenden jüdischen Männern, Frauen und Kindern, sowie die 40 Tagebücher des damaligen Generalgouverneurs von Polen und angeklagten Hauptkriegsverbrechers Hans Frank. Dann folgte noch die zunächst zeugenlose Anklage gegen die SS, die Gestapo und den SD. Die Tribünen im Prozesssaal waren allerdings schon weitgehend leer. Publikum und Presse hatten nun andere Sorgen. Das erste Weihnachtsfest nach dem Kriege musste vorbereitet werden.
Zum abschließenden Höhepunkt wurde der 3. Januar 1946, als man den ehemaligen SD-Chef, Juristen und SS-General Otto Ohlendorf in den Zeugenstand bat. Er war 1942 verantwortlich für die Ermordung von 90 000 Juden in der Ukraine und im Kaukasus. Er wurde 1948 im Einsatzgruppenprozess (Fall 9) angeklagt und zum Tode verurteilt. Für die Alliierten war er zunächst einer ihrer wichtigsten Zeugen. Er schilderte die von ihm angeordneten Massentötungen emotionslos sachlich und im Detail, machte allerdings unter Verweis auf den Befehl Hitlers aus der Vorkriegszeit zur Liquidierung aller Juden schuldentlastenden Befehlsnotstand geltend. (Sowade 1999, S. 188–220) Die Amerikaner hatten erreicht, was sie wollten. Göring war außer sich und beschimpfte Ohlendorf, dieser habe „seine Seele dem Feind verkauft“. Und Speer goss noch Öl ins Feuer. Durch seinen Verteidiger ließ er den Zeugen fragen, ob dieser bestätigen könne, dass er, Speer, im Februar 1945 versucht habe, Hitler umzubringen und Himmler an die Alliierten auszuliefern. Göring tobte und nannte Speer einen „Verräter“. (Gilbert 2012, 104f.)
Noch vor Weihnachten begann die Anklage gegen die verbrecherischen Organisationen, also gegen das „Korps der Politischen Leiter“, die „Reichsregierung“, „SA“, „Gestapo“, „SS“ und „SD“ und nicht zuletzt die „Gruppe“ „Generalstab und Oberkommando“. Für letztere war der Chefankläger der Nachfolgeprozesse, der amerikanische Oberst Telford Taylor, verantwortlich. Der Komplex der kollektiven Kriminalität sollte durch ein Urteil „deklaratorischen Charakters“ entschieden werden. Insofern diese Organisationen Gewalt und Terror ausgeübt hatten, waren sie später von der Masse der Deutschen zu trennen und durch die Besatzungsmächte „einer besonderen Behandlung zuzuführen“. (v.d. Lippe 1951, 153)
Für den Abschluss hatte man sich die Individualanklagen aufgehoben. Vorbehaltlich des noch ausstehenden Beweismaterials der französischen und sowjetischen Ankläger bemühten sich jetzt ihre britischen Kollegen, die Verbrechen zu konkretisieren. Das Gericht war sich bewusst, dass dabei Wiederholungen unvermeidlich waren. Um diese einzuschränken, verzichtete es auf die Fälle Ley und Krupp und hielt auch für Sauckel und Speer keine Spezialanklage mehr für erforderlich. Sie waren im Komplex „Sklavenarbeit“ nach Auffassung des Gerichts erschöpfend behandelt worden. Im Fall Kaltenbrunner verwies man auf die allgemeine Anklage gegen Gestapo und SD. So beschränkten sich die Spezialanklagen auf Göring, Ribbentrop, Frank und Rosenberg, Keitel, Raeder, Dönitz und Jodl, Streicher, Funk und Schacht, Schirach und Frick.
Zwei Wochen nach dem deutschen Mordbürokraten Ohlendorf erlebte das Gericht eine ganz andere Weltsicht auf das Großverbrechen. Für einen Augenblick schien es sich in einen Universitätshörsaal verwandelt zu haben. Die Rede des französischen Chefanklägers blieb wohl manchem durch die Schönheit der Sprache, die brillante Begrifflichkeit und die intellektuelle Eleganz in Erinnerung; „eliminierender Antisemitismus“, „Holocaust“ und „Zivilisationsbruch“ waren noch unbekannte Worte, aber mancher schien wohl zu ahnen, dass etwas Weltunbekanntes geschehen war. Am 17. Januar 1946 begann Francois de Menthon seinen Vortrag. Der Abkömmling eines alten burgundischen Rittergeschlechtes, Jurist, Professor für Politische Ökonomie an der Universität Lyon, Begründer der Christlichen Arbeiterjugend Frankreichs und unter de Gaulle Justizminister, richtete seine Anklage nicht nur gegen Hitler und das Dritte Reich. Deutschland als Ganzes nahm er in den Blick. So war es nur konsequent, dass er die Verherrlichung der Gewalt und der Rasse durch den Nationalsozialismus einerseits auf seine geschichtlichen Grundlagen zurückführte, um in dieser Gewaltideologie andererseits einen Protest zu erkennen gegen den Relativismus und Skeptizismus der modernen Welt. Der Nationalsozialismus, so Menthon zugespitzt, habe gegen den moralischen, geistigen und ästhetischen Werteverfall und die Orientierungslosigkeit der Massen die „Ideen und körperlichen Wahrzeichen der Rassentheorie“ gesetzt, eine „diktatorische Biologie“. (IMT 1947, Bd. V, 421)
Tagelang wurden danach, gestützt auf Hunderte von Dokumenten, Verbrechen im Detail vorgetragen: Zwangsrekrutierung von Fremdarbeiten, Ausplünderung der besetzten Gebiete, Gestapogräuel, Misshandlungen von Kriegsgefangenen und Deportierten in den Lagern und Gefängnissen, Kunstraub, Zerstörung wertvoller Kulturgüter etc. Der ebenso langwierige wie anstrengende Dokumentenvortrag der Anklage machte bald weitere personelle Wechsel erforderlich. Am 1. Februar folgte der junge Jurist und Abgeordnete Edgar Faure (PR); er hielt die dritte und abschließende Anklagerede. Auch er war Mitglied der Résistance gewesen und übernahm in der Nachkriegszeit, in der IV. wie in der V. Republik, als Minister und Ministerpräsident mehrfach Regierungsaufgaben. Dem auch publizistisch erfolgreichen Politiker, der u.a. politiktheoretische Werke verfasste, war es vergönnt, in Nürnberg eine frühe formelhafte Charakterisierung für den Nationalsozialismus zu finden. Faure hatte, wie andere Intellektuelle und Schriftsteller auch, erlebt, dass dieser sich in Frankreich nicht nur auf Gewalt, Angst und Chaos stützte, sondern zumindest zeitweilig auf eine gewisse ästhetische Massenfaszination. Die Herrschaft des Nazismus, so Faure, stütze sich auf eine „Philosophie des Verbrechens“ und eine effektiv organisierte „Bürokratie des Verbrechens“. (IMT 1947, Bd. 7, 32/5.2.46)
Hatte Menthon die Rassentheorie als den eigentlichen Antrieb für den deutschen Angriffs- und Vernichtungskrieg in den Mittelpunkt seiner Anklagerede gestellt und sich vor allem mit der „wirtschaftlichen Ausplünderung in Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark und Norwegen befasst, thematisierte General Rudenko zunächst die territorialen und quantitativen Ausmaße der von den „faschistischen Angreifern“ errichteten „Schreckensherrschaft“ im Osten Europas. Die „Hitlerbanden“ und „ihre Spießgesellen“ aus Finnland, Rumänien und Ungarn, so Rudenko weiter, hätten über 3000 religiöse Gebäude zerstört, 43 000 öffentliche Bibliotheken, 84 000 Schulen, 40 000 Spitäler, 36 000 Poststationen, 31 000 Industriebetriebe und 65 000 km Eisenbahnschienen. So wie die französischen Ankläger für die kleineren westeuropäischen Staaten sprachen, bezogen die sowjetischen die östlichen ein. Als Rudenko in der Aufzählung der Länder und Völker, die unter der deutschen Besatzung gelitten hätten, auch Polen nannte, empörten sich Göring, Heß und Schirach; jeder wisse doch, dass Hitler und Stalin zuvor Polens Zerstörung und Aufteilung verabredet hätten.
Am 11. Februar übernahm General Zorya den Anklagevortrag. Er stützte sich nicht nur auf schriftliches Beweismaterial, sondern auch auf Aussagen von Zeugen. Zumal von solchen, die entscheidend an der Vorbereitung dieses Angriffs mitgewirkt hätten wie der durch den Kampf um Stalingrad bekannt gewordene Generalfeldmarschall Friedrich Paulus. Man wusste nur, dass sich der legendäre Oberbefehlshaber der 6. Armee und mittlerweile Hitler-Gegner als Kriegsgefangener in der Sowjetunion aufhielt. Zorya wollte gerade beginnen, eine persönliche Erklärung von Paulus vorzutragen, als ihn der Verteidiger des Angeklagten Keitel unterbrach mit der Frage nach der Beglaubigung dieses erst im Januar in der Sowjetunion entstandenen Dokuments. Worauf Zorya erwiderte, „die Mitteilungen von Paulus […] können spätestens bis heute Abend geprüft werden, [sofern] Friedrich Paulus vor den Gerichtshof vorgeladen wird.“ (IMT 1947, Bd. 7, 280f./11.2.46; Taylor 1994, 364). Für einen Augenblick herrschte gespannte Stille im Gerichtssaal. Mit diesem prominenten und politisch umstrittenen Zeugen hatten die Russen einen filmreifen Coup gelandet. Dann war Mittagspause. Zur Nachmittagssitzung erschien die nun informierte Presse vollzählig, der Verhandlungssaal war überfüllt, die Verteidigung hatte das Nachsehen; sie war auf diese Sensation nicht vorbereitet.
Auf die Frage des sowjetischen Chefanklägers, was er über die Vorbereitung des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion wisse, antwortete Paulus knapp und umfassend zugleich, im professionellen Habitus des Generalstabsoffiziers. Danach wollte Rudenko von ihm wissen, wer von den Generälen auf der Anklagebank aktiv an diesen Vorbereitungen teilgenommen habe.
Darauf Paulus: „ […] der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Keitel, der Chef des Wehrmachtführungsamtes Jodl und Göring in seiner Eigenschaft als Reichsmarschall, als Oberbefehlshaber der Luftwaffe und als Bevollmächtigter auf dem rüstungswirtschaftlichen Gebiet.“ Abschließend wollte Rudenko wissen: ob „die Hitler-Regierung und das OKW einen Angriffskrieg gegen Sowjetrußland schon lange vor dem 22. Juni […] zum Zwecke geplant [hätten], dieses Territorium der Sowjetunion zu kolonisieren“, worauf Paulus antwortete, er habe daran „keinen Zweifel“. (IMT 1947, Bd. 7, 291) Danach hatte das Gericht keine Fragen mehr, und die Verteidiger baten darum, das Kreuzverhör auf den nächsten Vormittag zu verschieben. So lange konnte vor allem der cholerische Göring nicht warten. In der Nachmittagspause des Gerichts explodierte er dann. Der Gerichtspsychologe hat die tumultuarische Szene festgehalten: „‘Fragen Sie das dreckige Schwein‘, ob er wisse, daß er ein Verräter ist! Fragen Sie ihn, ob er seine russische Staatsbürgerschaft erhalten hätte?‘ schrie Göring seinem Anwalt zu. […] ‘Wir müssen diesen Verräter entlarven!‘ brüllte er.“ Die anderen verhielten sich taktisch klüger und blieben zurückhaltend. (Gilbert 2012, 147)
Den Abschluss der Anklage bildeten Ende Februar die beiden besonders schwierigen Themen „Judenverfolgung in Osteuropa“ und „Organisationen“; besonders schwierig wegen der Kriterien, der Beweismittel und der Langzeitperspektive, die mit ihren mutmaßlichen Folgen und deren Regulierung verbunden sein würden. Es hatte also seinen besonderen Grund, dass am 70. Prozesstag noch einmal der Chefankläger selbst das Wort ergriff, um ausgehend von Art. 6 des Gerichtsstatuts in einem weit ausholenden, rechtsvergleichenden Vortrag zu erörtern, warum und inwiefern die Anklage gegen „Organisationen“ und „Gruppen“ deren „kollektive Kriminalität“ bestimmen und durch das Gericht in einem Urteil „deklaratorischen Charakters“ entscheiden lassen wolle, „ein Urteil, dass weder gegen die Organisationen noch gegen deren Einzelmitglieder eine Bestrafung ausspricht.“ (IMT 1947, Bd. 8, 393/28.2.46)
Um auch die Zustimmung jener zu gewinnen, die im Gericht mit „kollektiver Kriminalität“ wenig anfangen konnten, ließ Jackson, der mit dem organisierten Verbrechen der amerikanischen Gangsterbanden während der Prohibition bestens vertraut war, mit Hilfe der Angeklagten das Bild einer hässlichen Realsatire entstehen – eine Skizze, die der volksgemeinschaftlichen Wirklichkeit in den Kriegsjahren nahekam: „Der Nazi-Despotismus bestand also nicht allein aus diesen einzelnen Angeklagten. Tausend kleine Führer diktierten, tausend Nachahmer Görings stolzierten umher, tausend Schirachs hetzten die Jugend auf, tausend Sauckels ließen Sklaven arbeiten, tausend Streichers und Rosenbergs fachten den Haß an, tausend Kaltenbrunners und Franks folterten und mordeten, tausend Schachts und Speers und Funks verwalteten, finanzierten und unterstützten die Bewegung. In jedem Kreis, jeder Stadt, jeder Ortschaft hatte die Nazi-Bewegung die vollkommene Gewalt inne. Die Macht der Partei, die sich aus diesem System von Organisationen ergab, stand zuerst mit der Staatsgewalt selbst in Wettstreit und beherrschte sie später völlig. […]“
Ausdrücklich betonte Jackson den über diesen Prozess hinausweisenden gerichts- bzw. besatzungspolitischen Zweck der Frage. „Es wäre keine von Gerechtigkeit und Klugheit bestimmte Besatzungspolitik für Deutschland, die passiven, unorganisierten und nicht eingegliederten Deutschen mit der gleichen Verantwortung zu belasten wie diejenigen, die sich freiwillig in diesen mächtigen und berüchtigten Banden zusammengeschlossen hatten.“ […] In diesem Verfahren handelt es sich lediglich um die Frage der kollektiven Kriminalität der Organisation oder Gruppen; sie soll durch ein Urteil deklaratorischen Charakters entschieden werden. Durch ein solches Urteil werden weder die Organisationen noch deren Einzelmitglieder bestraft.“ (IMT 1947, Bd. 8, 388ff.; Jackson 1946, 74ff.) Man kann vermuten, dass Jackson auch die frühen Analysen der NS-Herrschaft deutscher Emigranten kannte, insbesondere den Dual State (1940) von Ernst Fraenkel und Franz Neumanns Behemoth (1942), die in Deutschland erst in den 1970er Jahren übersetzt und zur Kenntnis genommen wurden.
5. Verteidigung, Kreuzverhöre, Replik des Chefanklägers
Die Verteidigung kam dadurch erst Anfang März 1946 dazu, in das Prozessgeschehen einzugreifen. Die Stunde der Kreuzverhöre und der Zeugen begann. Auch die Angeklagten konnten, wie im amerikanischen Prozessrecht üblich, von ihren Anwälten, den Richtern und Anklägern als Zeugen befragt werden. Letztere verhielten sich in diesem Stresstest sehr unterschiedlich, versuchten aber bis auf wenige Ausnahmen, ihre Verantwortung und ihre Schuld zu relativieren: Den verbrecherischen Charakter des Geschehens bestritten sie zumeist nicht, verwiesen aber auf ihre Abhängigkeit insbesondere von Hitler, Himmler und Goebbels, und machten zudem geltend, oppositionell und zu Gunsten Dritter gehandelt zu haben.
Im Zeugenstand wurde zunächst mit großem Interesse Hermann Göring erwartet. Nach mäßigen Schulleistungen vom Vater vor dem 1. Weltkrieg zur Offiziersausbildung auf eine Kadettenanstalt geschickt, wurde er Jagdflieger, lebte nach dem Krieg zeitweise in Schweden und traf erstmals 1922 in München mit Hitler zusammen. Das Gericht gab ihm, dem prominenten „Nazi Nr. 2“, Gelegenheit, seine Stellung in der Hierarchie des NS-Regimes darzustellen. Bereitwillig übernahm er die Rolle des informellen Sprechers der Angeklagten und wie selbstverständlich auch für Vieles „die Verantwortung“; zeigte sich gut vorbereitet, war informiert, oft besser als die, die ihn befragten, sprach frei und fließend und beeindruckte das Gericht, wie ein Beobachter schreibt, vor allem durch „Festigkeit, Sarkasmus, Vitalität – und Eitelkeit.“ Ein amerikanischer Pressevertreter nannte ihn: „Very clever“ (v.d. Lippe 1951, 181). Chefankläger Jackson tat sich in seinen Befragungen teilweise schwer.
Der schwedische Zeuge und Industrielle Birger Dahlerus, der noch im August 1939 in einer aufwendigen Reisediplomatie zwischen London und Berlin, Chamberlain und Hitler, vermittelt und den Frieden zu retten gesucht hatte, verhalf ihm allerdings nicht zu der erhofften Entlastung. Weder Hitler noch Göring hätten ernstlich die Absicht gehabt, den Krieg zu vermeiden. Göring sei an vielen Gesprächen zwar beteiligt gewesen, für die Entscheidungen aber bedeutungslos geblieben betonte Dahlerus.
Görings Glaubwürdigkeit war damit außenpolitisch verspielt. Dann scheiterte er auch mit seinem taktischen Konzept, in allen wichtigen politischen Fragen zwar beteiligt gewesen zu sein, aber mäßigenden Einfluss auf Hitler und die Regierung ausgeübt zu haben. Die Ausschaltung und Ausweisung der Juden habe er für richtig gehalten, räumte er ein, bestritt aber, von der Ausrottung in den Konzentrationslagern gewusst zu haben. Man konnte ihm zahlreiche, von ihm selbst unterschriebene judenpolitische Anordnungen vorlegen. Ein Schlüsseldokument ließ schließlich keinen Zweifel, Görings Anweisung an den SS-Gruppenführer Heydrich vom 31. Juli 1941:
„In Ergänzung der Ihnen bereits mit Erlaß vom 24.Januar 1939 übertragenen Aufgabe, die Judenfrage in Form der Auswanderung oder Evakuierung einer den Zeitverhältnissen entsprechend möglichst günstigen Lösung zuzuführen, beauftrage ich Sie hiermit, alle erforderlichen Vorbereitungen in organisatorischer, sachlicher und materieller Hinsicht zu treffen für eine Gesamtlösung der Judenfrage im deutschen Einflußgebiet in Europa […] Ich beauftrage Sie weiter, mir in Bälde einen Gesamtentwurf über die […] Vorausmaßnahmen zur Durchführung der angestrebten Endlösung der Judenfrage vorzulegen.“ (IMT 1949, Bd. 9, 575f./20.3.46)
Joachim von Ribbentrop, der die Zuständigkeit des Gerichts von Anfang an bestritten hatte, war zu einem Kreuzverhör kaum in der Lage. Keiner sei so „gealtert“ und so „verfallen“, schreibt ein Beobachter – und dabei erst 53 Jahre alt. (zit. Kastner 2005, 98). Mit Wilhelm Keitel, Hannoveraner Gutsbesitzersohn, der ursprünglich Landwirt werden wollte, trat gleichfalls ein gebrochener Mann in den Zeugenstand. Hitlers einst willfähriger Generalfeldmarschall trug schwer an seiner Schuld. Göring hatte sie ihm ausreden wollen – und Keitel einen Augenblick geschwankt. Unsicher sah er während des Verhörs mal zu jenem, mal zum vorsitzenden Richter. Aber zu Beginn seines mehrtägigen Kreuzverhörs hatte er sich besonnen, denn er litt darunter, dass durch ihn auch jene schuldig geworden waren, die seine Befehle ausführen mussten. Am 5. April 1946 erklärte er:
„Ich war Soldat, ich kann sagen aus Neigung und Überzeugung. Ich habe über 44 Jahre ununterbrochen meinem Vaterland und meinem Volke als Soldat gedient und habe das Bestreben gehabt, mein bestes Können in den Dienst meines Berufes zu stellen. […] / Als Deutscher halte ich es für meine selbstverständliche Pflicht für das einzustehen, auch dann, wenn es falsch gewesen sein mag. Ich bin dankbar, daß mir Gelegenheit gegeben wird, hier und vor dem deutschen Volke Rechenschaft abzulegen darüber, was ich war und über meinen Anteil am Geschehen. Ob Schuld oder schicksalsmäßige Verstrickung.“ (IMT 1947, Bd. 10, 529f./3.4.46)
Ernst Kaltenbrunner, Österreicher, promovierter Jurist, Burschenschaftler und Absolvent des Linzer Gymnasiums, wo er auch seinen späteren Untergebenen Adolf Eichmann kennengelernt hatte, zeigte sich in einer ungleich besseren mentalen und geistigen Verfassung, kenntnisreich, konzentriert und schlagfertig; er konnte im Verhör durch Telford Taylor diesem immer wieder Fehler oder Ungenauigkeiten nachweisen. Einerseits übernahm er für alles die Verantwortung, was seit seiner „Ernennung zum Chef des Reichssicherheitshauptamtes […] an Unrecht begangen wurde.“ Versuchte aber doch die Schwere dieses Eingeständnis durch den Hinweis abzuschwächen, „dass sein eigentliches Arbeitsgebiet der Nachrichtendienst“ gewesen sei; alle anderen Abteilungen hätten Himmler direkt unterstanden. Zudem behauptete er, bei zahlreichen Briefen und Befehlen, die seinen Namen trugen, dass es sich um Unterschriftsstempel und Fälschungen handeln würde. (IMT 1947, Bd. 11, 352ff./12.4.46; v.d.Lippe 1951, 217f.)
Sein Verteidiger Kauffmann ließ den Kommandanten des Vernichtungslagers Auschwitz als Zeugen laden: Der wenig später in Polen angeklagte und dort zum Tode verurteilte Rudolf Höß hatte im Bewusstsein seines bevorstehenden Todes autobiographische Aufzeichnungen gemacht, die erst später bekannt wurden. Ein aufschlussreiches schmales Buch über einen Massenmörder. Darin beschreibt er sich als einen distanzierten und schon als Kind weitgehend isolierten Menschen. Kriegsfreiwilliger, mit 17 Jahren jüngster Unteroffizier im Kaiserreich, Beteiligung an einem Fememord. Während seines Zuchthausaufenthaltes spielte er Schach, lernte Englisch und beschäftigte sich mit Rassenkunde, Vererbungslehre und dem Verhalten von Häftlingen. 1934 begann seine SS-Karriere im KZ Dachau, 1943 kam er nach Auschwitz. Er bewährte sich als der leitende Ingenieur des Häftlings- und Vernichtungslagers. In Nürnberg bestätigte er im Kreuzverhör seine auch schriftlich vorgelegte, überhöhte Schätzung, wonach in Auschwitz etwa 2,5 Mio. Männer, Frauen und Kinder durch Vergasung und weitere 500 000 durch Hunger und Krankheit getötet worden seien. Ob die „Massenvernichtung der Juden notwendig war oder nicht“, darüber wollte er kein Urteil abgeben, schreibt er, schreibt aber auch und offenbar nicht ohne Stolz, dass Auschwitz nach dem Willen Himmlers unter seiner Leitung „die größte Menschen-Vernichtungs-Anlage aller Zeit“ wurde. (zit. Reichel 2001, 170f. Für die von der Forschung ermittelten Zahlen der Ermordeten vgl. Benz 1996)
Alfred Rosenberg stammte aus einer deutsch-baltischen Familie und hatte als Student in Moskau die Oktoberrevolution erlebt, für ihn wie für die russischen Rechtsextremisten das Schlüsselereignis der „jüdisch-freimaurerischen Weltrevolution“. Er versuchte, sich als NS-Philosoph darzustellen, der die NS-Ideologie an Goethe, Fichte und Herder anschließen wollte. Im Kreuzverhör durch den US-Ankläger Thomas Dodd konnte er allerdings nicht verbergen, dass er sich in Übereinstimmung mit dem berüchtigten Acht-Punkte-Programm Bormanns vom 23.Juli 1942 befunden und entsprechend verhalten habe; Ziel sei es gewesen, die Slawen auf der untersten Stufe von Sklavenvölkern zu halten. Immer wieder beteuerte Rosenberg, in „Schreiben an den Führer“ für die Abschwächung der „schändlichen und schmutzigen“ Grundsätze eingetreten zu sein. Stundenlang weigerte er sich zuzugeben, was die ihm vorgelegten Dokumente eindeutig bewiesen, dass er über organisatorische Einzelheiten der „Ausrottung“ der Juden nicht nur informiert, vielmehr an dieser auch durch Verwaltungshandeln direkt beteiligt war. (IMT 1947, Bd. 11, 576–618/ 17.4.46)
Der vormalige Generalgouverneur des besetzten Polen, Hitlers Rechtsanwalt und höchster Jurist im Dritten Reichel, Hans Frank, der der Anklage 43 Tagebücher übergab (Klessmann 1971, S. 245–260), während der Haft seine Memoiren schrieb („Im Angesicht des Galgens“), zum Katholizismus konvertierte, sich nun als gläubiger Christ schuldig bekannte und Deutschland mit Pathos und theatralischer Geste für die kommenden „Tausend Jahre“ gleich mit verdammte, war so mitteilungsbedürftig wie auf Wirkung bedacht – und schwankend in seiner Einstellung. Dem Gerichtspsychologen gegenüber zeigte er sich erleichtert und erfreut darüber, dass er das Gericht, wie er glaubte, durch „seine Aufrichtigkeit“ beeindruckt hatte. Auch sein Verteidiger Dr. Seidl bemühte sich, gestützt auf die Tagebücher, das andere, menschliche Bild des Hans Frank aufscheinen zu lassen. Die Mitangeklagten reagierten erbost oder lächelten nachsichtig und waren sicher, dass sich die Richter von diesem bekenntnisfreudigen Melodramatiker kaum täuschen lassen würden. Im Schlusswort am 31. August 1946 nahm Frank, den sie den „Schlächter von Polen“ nannten, sein Schuldbekenntnis wieder zurück. Joachim Fest hat ihn die „Kopie eines Gewaltmenschen“ genannt, die entstanden sei „aus dem Nachahmungstrieb eines schwächlichen Exzentrikers, der sich seiner Schwäche ebenso schämte, wie er die selbstsichere Roheit bewunderte.“ (Fest 1980, 288)
Die danach vorgesehene Anhörung des vormaligen Innenministers Wilhelm Frick entfiel; dessen Verteidiger Dr. Pannenbecker hielt den Zeugen Dr. Hans Gisevius für geeigneter, eine Gesamtdarstellung der deutschen Polizei im Machtgefüge des Dritten Reiches zu geben. Julius Streicher hinterließ mit seinem Auftreten einen eher unangenehmen Eindruck und bemühte sich nicht einmal, taktisch den Erwartungen des Gerichts zu entsprechen. Er war eines von neun Kindern eines Volksschullehrers, übernahm den Beruf des Vaters, trat früh durch einen aggressiven Vulgärantisemitismus hervor. Streicher glaubte sich als „unbestechlichen Wahrheitsfanatiker“ vorstellen zu sollen, und behauptete, mit dem „Stürmer“ seine Leser nicht aufgehetzt, sondern aufgeklärt zu haben. Auch Hjalmar Schacht versuchte sich herauszureden. Er habe sich durch die Ablehnung des Versailler Friedens Hitler genähert, aber ab 1938 eine oppositionelle Haltung zu ihm eingenommen. Walter Funk, sein Nachfolger als Reichsbankpräsident, zudem Wirtschaftsminister, machte es ihm nach; mehr noch, er versuchte sogar, sich als Retter von Prominenten hervorzutun. Und natürlich nutzte auch er das schuldentlastende Argument, dass er Risiken eingegangen sei und ausgeharrt habe, um Schlimmeres zu verhindern. Der ostpreußische Unternehmersohn Funk war wie Frick, Frank, Kaltenbrunner und Seyß-Inquart promovierter Jurist, hatte außerdem eine Journalistenausbildung absolviert und verfügte über gute Kontakte zur Großindustrie, was ihm ermöglicht hatte, für Hitler geheime Parteispenden einzuwerben.
Für Karl Dönitz, der auf Hitlers Anweisung am 1. Mai 1945 in Flensburg die Geschäftsführende Reichsregierung übernommen hatte, schien die Sache einfacher und die Schuldfrage schon beantwortet: Als Offizier habe er den politischen Entscheidungen und Befehlen „des Führers“ folgen müssen. Sein Verteidiger, Dr. Kranzbühler, versuchte ihn mit Hinweis auf den tu quoque-Grundsatz zu entlasten. Er konnte nachweisen, dass die britische Admiralität und die US-Navy ihren Verbänden ähnliche Befehle gegeben hatten wie die deutsche. Leichteres Spiel mit der Selbstentlastung glaubten der Dönitz-Vorgänger Erich Raeder und sein Verteidiger zu haben. Immerhin konnten sie auf die „Moskauer Erklärung“ verweisen. Nach seiner Verhaftung durch die Sowjets hatte Raeder seinen Nachfolger wie auch Göring und Keitel beschuldigt und versucht, sich als Hitler-Gegner darzustellen. In das geschönte Bild seiner Biografie gehört auch, dass er nun die „Peinlichkeit“ einer durch Goebbels verbreiteten Propaganda-Lüge einräumen musste. Nicht Churchill habe durch eine Zeitbombe die Versenkung des britischen Passagierschiffes „Athenia“ angeordnet; ein deutsches U‑Boot hatte sie im September 1939 versehentlich versenkt – und Raeder hatte dieses Verbrechen sofort vertuscht.
Baldur von Schirach, vormals HJ-Führer und Gauleiter von Wien, setzt diese Einerseits-Andererseits-Argumentationslinie fort, um am Schluss ein Schuldbekenntnis abzulegen. Er stammte väterlicherseits aus einem sorbisch-deutschen Adelsgeschlecht, mütterlicherseits war er Nachfahre von Arthur Middleton, einem der Gründerväter der USA. Das Milieu, in dem er aufwuchs, war zugleich progressiv-international und konservativ-national. Bis zum 5. Lebensjahr sprach er nur Englisch. Schirach studierte Germanistik und Kunstgeschichte, war seit 1928 NS-Studentenführer und seit 1931 Reichsjugendführer.
Seine antisemitische Einstellung leugnete er so wenig wie die Mitwirkung beim Abtransport der etwa 60 000 Wiener Juden Anfang 1941, hielt sich aber zugute, dass er die von Goebbels geplante Reichspogromnacht 1938 abgelehnt und auch dafür gesorgt habe, dass die Hitler-Jugend bei dieser Aktion nicht eingesetzt wurde. Noch nach der Besetzung Ungarns habe er Hitler für den Plan zu gewinnen versucht, die Juden des Balkans in ein neutrales Land auswandern zu lassen. Am Schluss des Verhörs durch seinen Verteidiger Sauter erklärte von Schirach: „Ich habe diese Generation im Glauben an Hitler und in der Treue zu ihm erzogen. Die Jugendbewegung, die ich aufbaute, trug seinen Namen. Ich meinte, einem Führer zu dienen, der unser Volk und die Jugend groß, frei und glücklich machen würde. Mit mir haben Millionen junger Menschen das geglaubt. Es ist meine Schuld, daß ich die Jugend erzogen habe für einen Mann, der ein millionenfacher Mörder gewesen ist.“ (IMT 1949, Bd. 14, 476f./2.4.46)
Ende Mai erschien Fritz Sauckel im Zeugenstand; ein Arbeiterkind, abgebrochene Schulbildung, Matrose, gelernter Dreher, gewerkschaftlich-sozialistisches Milieu, Vater von 10 Kindern, NSDAP-Mitglied seit 1925, 1927 Gauleiter von Thüringen, seit 1942 verantwortlich für die Deportation von 8 Millionen Fremdarbeitern aus den besetzten Gebieten für den kriegsbedingten Arbeitskräftebedarf in Rüstungsindustrie und Landwirtschaft. Der weitaus größte Teil von ihnen waren Polen und Russen. Auch dieser Angeklagte suchte sich zu entlasten. Verteidiger und frühere Mitarbeiter schönten die Verhältnisse und Zahlen. Am Ende musste er zugestehen, dass nur weniger als 10 Prozent der von ihm und seiner Behörde kriegswirtschaftlich verwalteten Arbeiter freiwillig ins Deutsche Reich gekommen waren. Mit einem Todesurteil rechnete er nicht. Bis zuletzt hielt er an dem Selbstbild eines „vaterlandsliebenden Idealisten“ fest; seine Führer-Bindung blieb ungebrochen. (IMT 1948, Bd. 15, 7–278/29.5.–1.6.46; v.d.Lippe 1951, 295–301)
Mit Alfred Jodl, Spross einer bayerischen Offiziersfamilie, seit August 1939 Chef des Wehrmachtführungsstabes im OKW, trat ab 3. Juni ein zweiter Generalstabsoffizier in den Zeugenstand, der den militärischen Typus des „Parteisoldaten“ (Fest, Gesicht 1980, 336) repräsentierte, dies zu sein aber – um Schuldentlastung bemüht – hartnäckig bestritt. Die Anklage warf ihm vor, dass er nicht nur maßgeblich an der Vorbereitung der Angriffskriege gegen die Sowjetunion („Barbarossa“) Dänemark und Norwegen („Weserübung“) beteiligt war, sondern auch an völkerrechtswidrigen Entscheidungen („Kommissarbefehl“) und den Deportationen der jüdischen Bevölkerung in die Vernichtungslager. Den Bewunderer Hitlers, der sich in seinem Tagebuch bitter beklagte, „daß der Generalstab nicht an das Genie des Führers glauben wolle“ (ebda.), hielt dies allerdings nicht davon ab, während der Sommeroffensive 1942 Hitlers operativen Eingriffen wiederholt zu widersprechen und seine Führungsposition zu gefährden. Er habe Hitler für „eine gigantische Persönlichkeit“ gehalten, die „allerdings zu einer infernalischen Größe geworden“ sei. Und deshalb wiederholt Befehle zum Schaden der Zivilbevölkerung („verbrannte Erde“) nicht ausführen lassen oder auf das militärisch unbedingt Notwendige beschränkt. (IMT 1948, Bd. 15, 279–612)
Arthur Seyß-Inquart, Sohn eines österreichischen Gymnasiallehrers, promovierter Rechtsanwalt in Wien, fand früh zu den österreichischen Deutsch-Nationalen um Engelbert Dollfuß. Er wurde 1938 NSDAP- Mitglied, auf Druck von Hitler und Göring kurzzeitig Bundeskanzler und Staatsoberhaupt, legalisierte in dieser Funktion den „Anschluss“ Österreichs, war in Wien bis 1939 „Reichsstatthalter“ Hitlers, der ihn ein Jahr später zum „Reichskommissar“ für die besetzten Niederlande ernannte, SS-Obergruppenführer (1941) und auch noch Reichsminister ohne Geschäftsbereich. Er bekannte, Katholik, Antisemit und Anhänger Hitlers lange vor seinem Parteieintritt gewesen zu sein; er stand auch zu seiner Verantwortung für das, was er im Namen des NS-Regimes und für dieses habe anordnen müssen, u.a. die Deportation von über 100 000 niederländischen Juden und etwa 250 000 Arbeitskräften, beklagte, nur geringen Einfluss auf SS, SD und Wehrmacht gehabt zu haben. Aber er bestand darauf, dass er den Versicherungen Hitlers und Himmlers vertraut hätte, die Juden würden während des Krieges in östliche Aufenthaltslager geschickt, vorübergehend – bis zu einer Neuansiedlung nach dem Kriege.
Franz von Papen stellte sich als Aristokrat aus christlich-konservativem Milieu vor, aufgewachsen auf einem Landsitz, der sich seit 900 Jahren im Familienbesitz befände. Er wies die Anschuldigungen gegen seine Person zurück und bestand darauf, Sprecher des „Anderen Deutschland“ gewesen zu sein. Er war auf Hindenburgs ausdrücklichen Wunsch im Kabinett geblieben und nach dem Röhm-Putsch zurückgetreten. Er hatte sich, immerhin nationalkonservativer „Steigbügelhalter“ des Hitler-Regimes, seit 1934 auch wiederholt gegen die Einschränkung der Menschenrechte, der Religionsfreiheit und gegen viele Exzesse gewandt. Aber er hatte eben auch die kollaborierende Nähe zu diesem gesucht. Als ihm der britische Ankläger Sir David vorhielt, „trotz des Röhm-Putsches, trotz der Ermordung seines eigenen Adjutanten, trotz des Dollfuß-Mordes, trotz der kriegerischen Außenpolitik […] immer weiter in der Regierung geblieben“ zu sein und wissen wollte: „Warum? Warum?“ konnte Papen nur wiederholen „ – anfangs müde und schließlich zornig […], er habe das aus Pflichtgefühl getan.“ (Gilbert 2012, 388) Als der KZ-Film den Angeklagten gezeigt wurde, bemerkte Gilbert, dass Papen die Hände vors Gesicht hielt. „Ich wollte Deutschlands Schande nicht sehen“, gestand er“. (Ebda., 53) „Er hatte sie nie sehen wollen, wie sehr er selbst sie auch gefördert hatte“, kommentiert Joachim Fest später diese körpersprachliche Reaktion. (Fest 1980, 223)
In Albert Speers Verteidigung und Kreuzverhör durch Jackson am 20./21. Juni vermischte sich ein kalkuliert differenziertes Schuldbekenntnis vorteilhaft mit seiner späten Attentatsabsicht. Der aus einer renommierten Mannheimer Baumeisterfamilie stammende Architekt begann mit einer knappen Darstellung seiner monumentalen Bauten in Berlin und Nürnberg, die er im Auftrag des „fanatischen Bauherrn Hitler“ errichtet hätte. Mit 36 Jahren habe er 1942 als Nachfolger des verunglückten Todt die Leitung des Rüstungsministeriums übernommen; ein Jahr später wären ihm bis zu 14 Mio. Arbeiter unterstellt gewesen, etwa 10 Prozent davon KZ-Häftlinge und ca. 400 000 Kriegsgefangene. In der letzten Phase des Krieges habe er Hitlers „Verbrannte Erde“-Befehle weder in den aufgegebenen östlichen Gebieten befolgt noch in den geräumten Teilen Deutschlands; im Januar 1945 erkannt, dass Hitler „das Schicksal des deutschen Volkes mit seinem eigenen identifizierte“, und im März, dass dieser bewusst „die Lebensmöglichkeiten des eigenen Volkes […] zerstören wollte.“ Sein Plan, Hitler durch Giftgas im „Führerbunker“ zu töten, sei aus technischen Gründen misslungen. Im abschließenden Kreuzverhör mit Jackson bekannte er sich nicht nur zur sektoralen Verantwortung als Rüstungsminister. Ausdrücklich anerkannte er seine „Gesamtverantwortung“, „denn wer soll […] sonst die Verantwortung für den Ablauf der Geschehnisse tragen, wenn nicht die nächsten Mitarbeiter um ein Staatsoberhaupt herum?“ (Gilbert 2012, 392ff.)
Constantin Freiherr von Neurath, Abkömmling einer württembergischen Ministerfamilie, war mit Rücksicht auf sein fortgeschrittenes Alter durch seinen Verteidiger vorbereitet. Lüdinghausen hatte nicht nur zahlreiche schriftliche Zeugenaussagen anfertigen lassen. Neuraths eigene Antworten lagen ebenfalls schriftlich vor, so dass er sie vorlesen konnte. Auch ihn hatte Hindenburg gebeten, nach der Machtübertragung im Amt zu bleiben. Gegen den Einfluss Ribbentrops habe er allerdings wenig ausrichten können. Lüdinghausen wies zudem darauf hin, dass Neurath bei der Münchener Konferenz als Vermittler aufgetreten sei und ihm der französische Botschafter Francois-Poncet dafür ausdrücklich gedankt habe. Die belastende Ernennung zum Reichsprotektor in Prag versuchte Neurath durch den Hinweis zu relativieren, dass Hitler dadurch habe dokumentieren wollen, keine tschechenfeindliche Politik zu planen. Besonders heftig war die attackierende Befragung durch den britischen und sowjetischen Ankläger zum Schluss. Im Stakkato fragte Nikichenkov: „Sie waren gegen den Überfall auf Polen? Ja. Trotzdem wurde Polen überfallen! Sie waren gegen den Überfall auf die Sowjetunion? Ja. Trotzdem […]“ (IMT 1948, Bd. 17, 114ff. (116)/26.6.46)
Am 26. Juni trat der Leiter der Rundfunkabteilung im Propagandaministerium, Hans Fritzsche, in den Zeugenstand. Der Sohn eines Postdirektors studierte ohne Abschluss Geisteswissenschaften, wurde DNVP-Mitglied, Journalist in einem Nachrichtdienst und kam dann ins Propagandaministerium. Er zeigte Reue, sah sich selbst als „getäuschtes Opfer“, hatte Durchhalteparolen verbreitet und durch seine wöchentliche Sendung „Hier spricht Hans Fritzsche“ auch eine gewisse Prominenz erreicht. Einen „führenden Propagandisten“ des „Dritten Reiches“, den später ein Spruchkammerverfahren in ihm sehen wollte, das ihn zu neun Jahren Arbeitslager verurteilte, erkannte man in Nürnberg in Fritzsche nicht; dort stand er im Schatten von Goebbels.
Den ganzen Juli hindurch hatten die Verteidiger das Wort; ihre Plädoyers standen im Mittelpunkt. Darauf antwortete am 26. Juli Robert Jackson mit seiner dritten großen Anklagerede. Sie ist weniger bekannt als die Eröffnungsrede, aber inhaltlich bedeutsamer, denn sie konnte nun auf ein abgeschlossenes Verfahren und die beteiligten Personen Bezug nehmen. Mochten die unmittelbar Betroffenen oft unfähig oder unwillig sein, sich für den analytischen Scharfsinn und die menschliche Größe des Anklägers zu öffnen. Jackson stellte ihnen den langwierigen Prozess noch einmal, nun pointiert, als „historischen Text der Schande und der Verderbtheit des zwanzigsten Jahrhunderts“ vor Augen. Er sei hier zitiert in der von Gustav Radbruch, dem Heidelberger Rechtsphilosophen und Weimarer Justizminister (SPD), edierten und sorgfältig übersetzten Fassung:
„Über einen Punkt können wir beruhigt sein“, begann er, „die Zukunft wird niemals besorgt fragen müssen, was die Nazis zu ihrer Verteidigung hätten vorbringen können. Die Geschichte wird sich darüber im klaren sein, daß sie die Möglichkeit hatten, alles zu sagen, was sie nur sagen konnten. Ein solches Verfahren, wie es gegen sie durchgeführt worden ist, haben sie selbst in den Tagen ihres Prunkes und ihrer Macht keinem Menschen gegenüber angewendet.
Aber die Anwendung von Recht und Billigkeit bedeutet nicht Schwäche. Die außerordentliche Unparteilichkeit, mit der diese Verhandlungen geführt wurden, ist ein Zeichen unserer Kraft. Tatsache ist, daß das Zeugnis der Angeklagten alle Zweifel an ihrer Schuld, die wegen der außergewöhnlichen Art und Größe dieser Verbrechen vor ihrem Verhör vielleicht bestanden haben mochten, beseitigt hat. Sie haben mitgeholfen, ihr eigenes Verdammungsurteil zu schreiben. […]
Der geistige Bankrott und die moralische Verderbtheit des Naziregimes hätten das Völkerrecht vielleicht gleichgültig lassen können, wenn seine Lehre nicht dazu benutzt worden wäre, das H e r r e n v o l k dazu zu bringen, die Grenzen anderer Völker zu überschreiten. Nicht ihre Gedanken werden hier als Verbrechen angeklagt, sondern ihre offenkundigen Taten. […]
In der Nachmittagsverhandlung hielt der britische Chefankläger Sir Hartley Shawcross seine abschließende Rede. Er widmete sich nur indirekt den Haupttätern; sprach über das zentrale Gewaltverbrechen, die Vernichtung der europäischen Juden, die Erschießung und Vergasung von mehr als sechs Millionen Kindern, Frauen und Männern. Und stützte sich, wie man es wohl von einem Staatsanwalt in einem solchen Strafprozess erwartet, auf Augenzeugen. Es handelt sich – und das mag diese Zeugnisse herausheben – um Aufzeichnungen von zwei nachmaligen Widerstandskämpfern – um den Bericht des deutschen Bauingenieurs Hermann Friedrich Graebe, der sich im Auftrag seiner Solinger Firma für Flughafenarbeiten im ukrainischen Dubno aufhielt und wenige hundert Meter von seiner Baustelle entfernt dies erlebte:
„Die von den Lastwagen abgestiegenen Menschen, Männer, Frauen, Kinder jeden Alters, mußten sich auf Aufforderung eines SS-Mannes, der in der Hand eine Reit- oder Hundepeitsche hielt, ausziehen und ihre Kleidung nach Schuhen, Ober- und Unterkleidung getrennt, an bestimmte Stellen ablegen. Ich sah einen Schuhhaufen von schätzungsweise 800 bis 1000 Paar Schuhen, große Stapel mit Wäsche und Kleidern. Ohne Geschrei oder Weinen zogen sich diese Menschen aus, standen in Familiengruppen beisammen, küßten und verabschiedeten sich und warteten auf den Wink eines anderen SS-Mannes […] Ich beobachtete eine Familie von etwa 8 Personen, einen Mann und eine Frau, beide von ungefähr 50 Jahren, mit deren Kindern, so ungefähr 1‑, 8- und 10jährig sowie zwei erwachsene Töchter von 20–24 Jahren. Eine alte Frau mit schneeweißem Haar hielt das einjährige Kind auf dem Arm und sang ihm etwas vor und kitzelte es. Das Kind quietschte vor Vergnügen. Das Ehepaar schaute mit Tränen in den Augen zu. Der Vater hielt an der Hand einen Jungen von etwa zehn Jahren, sprach leise auf ihn ein. Der Junge kämpfte mit den Tränen. Der Vater zeigte mit dem Finger zum Himmel, streichelte ihn über den Kopf und schien ihm etwas zu erklären. Da rief schon der SS-Mann an der Grube seinem Kameraden etwas zu. Dieser teilte ungefähr 20 Personen ab und wies sie an, hinter den Erdhügel zu gehen. Die Familie, von der ich hier sprach, war dabei. Ich entsinne mich noch genau, wie ein Mädchen, schwarzhaarig und schlank, als sie nah an mir vorbeiging, mit der Hand an sich herunterzeigte und sagte ‚23 Jahre‘. Ich ging um den Erdhügel herum und stand vor dem riesigen Grab. Dicht aneinander gepreßt lagen die Menschen so aufeinander, daß nur die Köpfe zu sehen waren. Von fast allen Köpfen rann Blut über die Schultern. Ein Teil der Erschossenen bewegte sich noch. Einige hoben ihre Arme und drehten den Kopf, um zu zeigen, daß sie noch lebten. Die Grube war bereits dreiviertel voll. Nach meiner Schätzung lagen darin ungefähr 1000 Menschen. Ich schaute mich nach dem Schützen um. Dieser, ein SS-Mann, saß am Rand der Schmalseite der Grube auf dem Erdboden, ließ die Beine in die Grube herabhängen, hatte auf seinen Knien eine Maschinenpistole liegen und rauchte eine Zigarette.“ (IMT 1948, Bd. 19, 568f.; Gilbert 2012, 421f.)
Diese Massentötung ist zweifach bezeugt. Was Sir Hartley noch nicht wissen konnte, hat uns ein zweiter Augenzeuge dieser Massenexekution bestätigt. Der junge Oberleutnant Axel von dem Bussche war zufällig am 5. Oktober auch auf dem Flugplatz Dubno und musste diese Massentötung von über dreitausend Zivilisten, überwiegend ukrainische Juden, mitansehen. Auch für ihn wurde dieses Erlebnis zu einem Wendepunkt. Wenig später fand er durch die Vermittlung von Fritz-Dietlof von der Schulenburg zum Widerstandskreis um Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Von dem Bussche überlebte und wurde einer der prominenten Sprecher des militärischen Widerstands gegen Hitler. Auch Gräbner überlebte. Aber er sah sich als „Vaterlandsverräter“ diffamiert und Anfang der 1950er Jahre gezwungen, mit seiner Familie in die USA zu gehen. Auch diese Geschichte gehört zu den Folgen des Nürnberger Prozesses.
Sir Hartley beendete seine lange Schlussrede mit den Sätzen:
„Einige mögen schuldiger sein als andere: Einige spielten eine tätigere und unmittelbarere Rolle als andere in diesem furchtbaren Verbrechen. Aber wenn es sich um Verbrechen handelt wie die, mit denen Sie hier zu tun haben – Sklaverei, Massenmord und Weltkrieg –, wenn die Folgen der Verbrechen der Tod von über 20 Millionen unserer Mitmenschen sind, die Verwüstung eines Erdteils, die Ausbreitung unsagbarer Tragödien und Leiden über eine ganze Welt, was für ein Milderungsgrund ist es, daß einige in geringerem Maße beteiligt sind, daß einige Haupttäter und einige nur Mittäter. […]
Dieser Prozeß muß zu einem Markstein in der Geschichte der Zivilisation werden, indem er nicht nur für diese schuldigen Menschen die Vergeltung bringt und nicht nur betont, daß Recht schließlich über das Böse triumphiert, sondern auch, daß der einfache Mann auf dieser Welt […] nunmehr fest entschlossen, das Individuum höher zu stellen als den Staat. […] ‚Der Vater‘ – erinnern Sie sich? – zeigte mit dem Finger gen Himmel und schien dem Jungen etwas zu sagen.“
6. Schlusswort der Angeklagten/Urteile
Ende September, Anfang Oktober 1946 neigte sich der Prozess dem Ende zu, die Urteile
wurden verkündet und vollstreckt. Für eine Verurteilung waren drei der vier Richterstimmen erforderlich. Die Hälfte der 24 Angeklagten wurde zum Tode verurteilt; sieben von ihnen erhielten Zeitstrafen, drei wurden freigesprochen. Ihre Gnadengesuche, auf die nur Kaltenbrunner und Speer verzichteten, lehnten die Richter ab. Eine Berufung war nach dem Londoner Statut ausgeschlossen. Die Todesurteile wurden am 16. Oktober im Nürnberger Zellengefängnis vollstreckt. Die zu Haftstrafen verurteilten mussten auf ihre Verlegung ins Spandauer Gefängnis bis zum Sommer 1947 warten.
Doch zuvor, am 31. August 1946, hatten sie Gelegenheit zu einem letzten öffentlichen Auftritt. Im vollbesetzten Gerichtssaal durften sie eine „uneidliche Aussage“ abgeben, also ihr Schlusswort sprechen. Nachdem sie – mit Ausnahme von Albert Speer – zunächst den Standpunkt von Göring teilten: „Die Sieger sind immer die Richter“, ließen einige schon während der Verhöre Unrechts- und Verantwortungsbewusstsein erkennen oder taten dies jetzt. Zehn Monate hatten sie auf der Anklagebank gesessen, zehn Monate hören müssen, was Ankläger, Richter, Zeugen und einstige Mittäter über ihre Stellung in Partei und Staat und über ihre Verbrechen aussagten. Zehn Monate waren sie mit erdrückendem Beweismaterial konfrontiert worden. Und sie wussten, dass ihr letztes Wort den Urteilsspruch der Richter nicht mehr beeinflussen konnte. Umso mehr fragte man sich im Gerichtssaal, ob der Prozess das Bewusstsein dieser Männer zumindest erreicht hatte.
Sie alle waren durch die Ereignisse ihrer Generation tief geprägt, immer wieder enttäuscht und betrogen: durch den Zusammenbruch der Monarchie, die Weltkriegsteilnahme, die Niederlage und die „Schmach von Versailles“. In ihrem nationalen Wir-Gefühl nachhaltig getroffen, hatten sie kein freiheitlich-humanes Wertebewusstsein, aber sie waren durch ihre militärische Erfahrung und den Schützengraben des 1. Weltkrieges kameradschaftsgeprägt und führergläubig. Diese 24 Angeklagten repräsentierten nicht nur das „Gesicht des Dritten Reiches“; in ihrem biografischen Profil zeigte sich durchaus auch „das Gesicht eines ganzen Volkes“. (Fest 1980, 409) In ihm spiegelte sich das Zeitalter der Weltkriege.
Ribbentrop wollte sich nur schuldig bekennen, weil er mit seiner Außenpolitik nicht die Folgen von Versailles beseitigt hatte. Keitel stützte der militärische Habitus: „Ich habe geglaubt, ich habe geirrt und war nicht imstande, zu verhindern, was hätte verhindert werden müssen. Das ist meine Schuld“, bekannte er. Auch Dönitz und Raeder räumten ein, dass sie politisch und moralisch versagt und sich gegenüber dem deutschen Volk schuldig gemacht hätten. Frick und Funk, Kaltenbrunner, Streicher und Rosenberg dagegen schoben alle Schuld auf ihre Vorgesetzten, sahen sich durch Hitler und Himmler getäuscht und missbraucht. Oder sie erwiesen sich als Verrechnungskünstler wie Frank. Dieser sprach zwar von seiner Schuld und der des deutschen Volkes, weil man Hitlers „Weg ohne Gott“ gefolgt sei, sah diese aber durch die „riesigen Massenverbrechen“ der Russen, Polen und Tschechen getilgt und widerrief sein früheres Geständnis. Das Schlusswort von Fritz Sauckel war das längste; aufschlussreich war es allemal. Er distanzierte sich zunächst von den Mitangeklagten. Nach Herkunft und Gesinnung Arbeiter sei er aus einer „übergroßen Hitlerverehrung heraus Nationalsozialist“ geworden. „Klassenkampf, Enteignung und Bürgerkrieg“ verurteile er. Nie habe er „fremde Menschen zu Sklaven machen“ wollen, aber im Krieg die ihm von Hitler übertragene Aufgabe erfüllen müssen.
Albert Speer tat in seiner abschließenden Erklärung viel, seine neue Karriere vorzubereiten; er dachte längst über das drohende Ende hinaus. Eine zurechenbare Schuld an den Kriegs- und Menschlichkeitsverbrechen bestritt er entschieden; eine Mitverantwortung für die Gewaltverbrechen übernahm er bereitwillig. Die Mitangeklagten waren schockiert, die Richter beeindruckt, auch dadurch, dass er sich habituell von jenen vorteilhaft unterschied. Bereits während der Prozessvorbereitung hatte er mit den Amerikanern zusammengearbeitet. Bei der Urteilsfindung bestand allerdings zunächst eine Pattsituation: Biddle und Nikitchenkov forderten die Todesstrafe, Sir Lawrence und Vabres plädierten für Gefängnis; Jackson ließ sich schließlich zugunsten einer Zeitstrafe überreden.
Kein anderer aus der NS-Führung, Hitler, Himmler und Goebbels ausgenommen, hat ein so großes, in der Öffentlichkeit bis in die Gegenwart anhaltendes Interesse gefunden. Albert Speer war, wie Eberhard Jäckel schon vor fünfzig Jahren schrieb, erst Hitlers „Lieblingsarchitekt“ und dann „Lieblingsminister“. (zit. Reichel 2007, 55ff., auch nachf. Zit.) Dank seines einsichtsvollen und kooperativen Verhaltens vor Gericht avancierte er bei den Alliierten zum „Lieblingsangeklagten“. Für die Deutschen wurde der späte Bestsellerautor und Medienstar schließlich zum „Lieblingsspätheimkehrer“. Der Sozialpsychologe Alexander Mitscherlich sprach nicht ohne Bewunderung von einem „feinsinnig Schuldig-Unschuldigen“. Gitty Sereny und Joachim Fest, seine Biografen, gingen davon aus, dass Speer sich spätestens ab Sommer 1945 mit einer „Strategie seines Überlebens“ beschäftigte. In Wort und Schrift gab er den Alliierten bereitwillig Auskunft – und verschwieg dabei wohl mehr als er offenbarte.
In der ersten Fassung seiner Erinnerungen kam die „Reichskristallnacht“ noch nicht vor; sein Verleger riet ihm, den Text für die Ausgabe von 1969 zu ergänzen. An die „Judenevakuierung“ im Zuge der unter seiner Verantwortung stehenden Umgestaltung Berlins zur „Welthauptstadt Germania“ mochte er so wenig erinnert werden wie an die Judenvernichtung. Jahrelang hatte er behauptet, von dem Verbrechen erst in Nürnberg Kenntnis erhalten zu haben. Nach intensiver Befragung durch Gitta Sereny bekannte er sich zu seiner Lebenslüge. Seine Hauptschuld sah er in der „Billigung durch Wegsehen“. Die öffentliche Selbstprüfung fand keineswegs nur Beifall. Der Schriftsteller Jean Amery kritisierte ihn scharf: „Sühne und Umkehr werden würdig nur in Einsamkeit vollzogen.“ Die Mehrheit der Deutschen sah das wohl anders. Er hatte als Autor Erfolg und fand auch als Mensch Verständnis und Wertschätzung. Mit ihm konnte sich mancher seines Jahrgangs identifizieren. Speer gehörte der zwischen 1900 und 1910 geborenen Kriegsgeneration an. Er war einer von jenen idealistisch gesinnten und akademisch ausgebildeten Männern aus gutbürgerlichem, zumeist nationalliberalem Hause, denen die Weimarer Republik fremd geblieben war und kaum Perspektiven geboten hatte und die sich ganz der nationalen Sache und der modernen Sachlichkeit verschrieben. Aus dieser technisch-wissenschaftlichen Intelligenz rekrutierte der NS-Staat das Personal für seine weitreichenden Ziele einer ‚reaktionären Modernität‘. Speer ist einer der prominentesten und erfolgreichsten Repräsentanten dieser neuen Elite des NS-Staates geworden. Sie hatte nach Herkunft, Bildung und technokratischer Moral wenig mit den in der Partei aufgestiegenen „Braunhemden“ und „Alten Kämpfern“ aus der Frühzeit der Bewegung zu tun. Zwischen Speer und Streicher lag eine Welt. Speers Karriere und seine Schuld sind ohne das politische Versagen einer ganzen Generation kaum zu verstehen. In den sog. Nachfolgeprozessen musste sie sich erstmals vor Gericht verantworten. Sie sind bis heute leider viel zu wenig in der Öffentlichkeit bekannt. (Ueberschär 1999)
Die Richter verlasen sodann das Urteil abschnittsweise. Einem Überblick auf die wichtigsten statistischen Zahlen folgten die Abschnitte zu den vier strafrechtlichen Tatbeständen. Die „Entfesselung eines Angriffskrieges“ bewertete das Gericht auf der Basis der „Schlüsseldokumente“ als „das schwerste internationale Verbrechen“; die „Verschwörung“ dazu definierte es enger als die Anklage, durch das Vorliegen eines konkreten Kriegsplans (Hoßbach-Protokoll v. 5.11.1937); für den Urteilsabschnitt über Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit legte es eine umfassende Auflistung vor und unterschied sechs verschiedene Gewaltverbrechen: 1. Misshandlung und Ermordung von Kriegsgefangenen; 2. Misshandlung und Ermordung der Zivilbevölkerung; 3. Plünderung öffentlichen und privaten Eigentums; 4. Zwangsarbeit; 5. Vernichtung von Geisteskranken und unheilbar Kranken; 6. Judenverfolgung.
Dem schloss sich das mit größter Spannung erwartete Urteil über die angeklagten „Organisationen“ an. Als verbrecherisch verurteilt wurden das „Korps der Politischen Leiter“, die Gestapo und der SD, sowie die SS. Ihre Angehörigen waren beteiligt an der Verfolgung und Ermordung der Juden, KZ-Verbrechen, Ausschreitungen in den besetzten Gebieten, Misshandlung und Tötung von Kriegsgefangenen usw. Nicht verurteilt wurden die SA, die Reichsregierung und der Generalstab. Die SA kam zu ihrem Freispruch, weil ihre Gewalttätigkeit vor 1934 nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang stand mit dem Angriffskrieg wie ihn das Statut definierte. Für den Freispruch der Reichsregierung sprachen zwei Argumente: Zum einen war sie nach 1937 nicht mehr als Gruppe in Erscheinung getreten, zum anderen gehörten zu ihr nur sehr wenige Personen. Dass Generalstab und Oberkommando freigesprochen wurden, mochte überraschen, wenn nicht befremden. Sie waren zwar keine Gruppe im Sinne des Statuts, aber doch „in großem Maße verantwortlich […] gewesen für die Leiden und Nöte, die über Millionen Männer, Frauen und Kinder gekommen sind“. […]“ Die Wahrheit ist, dass sie an all diesen Verbrechen rege teilgenommen haben oder in schweigender Zustimmung verharrten, wenn vor ihren Augen größere und empörendere Verbrechen begangen wurden als sie die Welt zu sehen je das Unglück hatte.“ (IMT 1948, Bd. 22, 595/30.9.46)
Am 1. Oktober wurden die Schuld- und Strafsprüche der Angeklagten verlesen – wiederum in der Reihenfolge, die ihrer Sitzordnung entsprach. Wechselweise ergriffen die Richter das Wort; hier nur die Urteile (IMT 1948, Bd. 22, 596–670/1.10.1946):
Göring: Nach allen vier Anklagepunkten schuldig. Tod durch den Strang.
Heß: Angeklagt nach I‑IV; schuldig nach I und II, nicht schuldig nach III und IV. Lebenslänglich Gefängnis
Ribbentrop: Angeklagt und schuldig nach I‑IV. Tod durch den Strang.
Keitel: Angeklagt und schuldig nach I‑IV. Tod durch den Strang.
Kaltenbrunner: Angeklagt nach I, III u. IV, schuldig nach III u. IV, nicht schuldig nach I. Tod durch den Strang.
Rosenberg: Angeklagt nach I‑IV; schuldig nach III u. IV, nicht schuldig nach I u. II. Tod durch den Strang.
Frank: Angeklagt nach I, III u. IV; schuldig nach III u. IV, nicht schuldig nach I. Tod durch den Strang.
Frick: Angeklagt nach I‑IV, schuldig nach II, III u. IV, nicht schuldig nach I. Tod durch den Strang
Streicher: Angeklagt nach I u. IV, schuldig nach IV, nicht schuldig nach I. Tod durch den Strang.
Funk: Angeklagt nach I‑IV, schuldig nach II-IV, nicht schuldig nach I. Lebenslänglich Gefängnis.
Schacht: Angeklagt nach I und II, aber Mitwirkung an der Aufrüstung „an sich nach dem Statut nicht verbrecherisch.“ Freispruch.
Dönitz: Angeklagt nach I‑III, schuldig nach II und III, nicht schuldig nach I. Weil auch die britische und amerikanische Seekriegsführung völkerrechtswidrig waren, erhob das Gericht gegen den deutschen U‑Bootkrieg keinen Schuldvorwurf. Zehn Jahre Gefängnis.
Raeder: Auch der zweite Admiral war angeklagt nach I, II und III und wurde auch in allen drei Punkten für schuldig befunden. Das ihm zur Last gelegte Kriegsverbrechen beruhte auf der stillschweigenden Weitergabe des völkerrechtswidrigen „Kommandobefehls“ Hitlers (18.10.1942). Lebenslänglich Gefängnis.
Schirach: Angeklagt nach I u. IV, schuldig nach IV, nicht schuldig nach I. 20 Jahre Gefängnis.
Sauckel: Nach I – IV angeklagt und schuldig. Tod durch den Strang.
Jodl: Angeklagt und schuldig nach I – IV. Tod durch den Strang.
Papen: Angeklagt nach I u. II. Keine verbrecherischen Handlungen i. S. des Statuts. Freispruch
Seyß-Inquart: Nach I – IV angeklagt, schuldig nach II, III und IV. Urteil: Tod durch den Strang.
Speer: Angeklagt nach I‑IV, schuldig nach III u. IV. 20 Jahre Gefängnis.
Neurath: Nach allen vier Punkten angeklagt und schuldig, wegen Rücktritt 1943 und Rettung Verfolgter: 15 Jahre Gefängnis.
Fritzsche: Nach I, III u. IV angeklagt. Schuld geringfügig. Freispruch.
Bormann: Angeklagt nach I, III u. IV, schuldig nach III u. IV. Tod durch den Strang (in Abwesenheit)
7. Wirkung
Mit dem Internationalen Militärtribunal Nürnberg hatten die Alliierten in mehrfacher Hinsicht Neuland betreten; dass daraus mit dem Vertrag von Rom 1998 bereits ein halbes Jahrhundert später die Einsetzung eines ständigen Internationalen Strafgerichtshofes durch die Vereinten Nationen hervorgehen würde, war 1946 nicht absehbar (dazu v.a. der Überblick bei Ahlbrecht 1999, 96–335). Den ersten Schritt trat das Kontrollratsgesetz Nr. 10. Ausdrücklich bezogen sich die Alliierten damit auf Intention und Inhalt der Moskauer Deklaration vom 30. Oktober 1943 und des Londoner Abkommens vom 8. August 1945. Art. II, 1a – 1d KRG 10 wiederholte zwar die entsprechenden Strafbestimmungen des IMT-Statuts, aber sie veränderten die Rechtsgrundlagen; maßgeblich war nun das jeweilige nationale Militärgericht und das allgemeine Besatzungsstrafrecht.
Den Anfang machten die zwölf großen Verfahren, die bis Mitte 1949 vor dem amerikanischen Gerichtshof in Nürnberg geführt wurden. Im sog. Ärzte-Prozess (I) waren 23 Personen wegen Mitwirkung im „Euthanasie“-Programm angeklagt. Im II. Prozess musste sich Generalfeldmarschall Milch wegen Mitwirkung am Rüstungsprogramm verantworten. Im „Juristenprozess“ (III) waren 16 Vorsitzende von Sondergerichten u.a. angeklagt. 18 Angehörige des Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes der SS mussten sich für die Verwaltung der Konzentrationslager verantworten (IV); Friedrich Flick und Mitarbeiter wegen der Ausbeutung von Zwangsarbeitern und des Raubs ausländischen Eigentums (V). Im VI. Prozess waren 23 leitende Angehörige der IG-Farben AG wegen Verschwörung zum Angriffskrieg und Kriegsverbrechen angeklagt. Im „Südost-Generale-Prozess“ (VII) mussten sich zwölf hohe Offiziere wegen Geiselerschießungen auf dem Balkan verantworten. Im VIII. Prozess waren 14 leitende Angehörige des RuSHA angeklagt. Im sog. „Einsatzgruppen-Prozess (IX) mussten sich 24 SD- und Polizei-Führer für ihre Mitwirkung an den mobilen Mordkommandos in den besetzten Ostgebieten verantworten. Der X. Prozess wurde gegen Alfried Krupp von Bohlen und Halbach und elf leitende Angestellte der Firma Krupp geführt, wegen Ausbeutung von Zwangsarbeitern und Ausplünderung von ausländischem Eigentum. Im XI. Verfahren, dem sog. Wilhelmstraßenprozess, standen 21 Minister, Gauleiter und höhere SS-Offiziere vor Gericht, wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Im XII. Verfahren mussten sich 14 hohe Wehrmachtsoffiziere wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten. In weiteren Prozessen wurde das Personal der Konzentrationslager Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Mauthausen und Mittelbau-Dora u.v.a. angeklagt.
Im zweiten großen Verfahren der Alliierten nach dem Zweiten.Weltkrieg mussten sich 28 Japanische Hauptkriegsverbrecher vom 8. Mai 1946 bis 12. November 1948 vor dem International Tribunal for the Far East (IMTFE) verantworten. Im Gegensatz zum Internationalen Militärtribunal Nürnberg beruhte dieser Prozess nicht auf einem völkerrechtlich legitimierten Einsetzungsakt. Andererseits folgte das IMTFE-Statut weitgehend dem IMT-Statut: Die Definition der Straftatbestände (Verbrechen gegen den Frieden; Konventionelle Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit glichen sich bis in den Wortlaut). Prozessführung, Beweiswürdigung und Verteidigung folgten dagegen nicht den Nürnberger Vorgaben. So wurden beispielsweise keine Beweisstücke zugelassen, die sich auf die abgeworfenen Atombomben bezogen. Das Gericht ignorierte sowjetische Aggressionen ebenso wie Verfahrensfehler des amerikanischen Chefanklägers Keenan.
Alle Angeklagten wurden schuldig gesprochen; mit Ausnahme des japanischen Kaisers Hirohito, der weder als Angeklagter noch als Zeuge vor Gericht erschien. Der Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte, General Mac Arthur, hatte ausdrücklich auf die rechtliche Unantastbarkeit des „göttlichen“ Herrschers hingewiesen und vor Widerstandsaktionen der Bevölkerung gewarnt. Im Übrigen erfolgte das Urteil der elf Richter nicht einstimmig; der französische, indische und niederländische Richter legten „dissenting opinions“ vor. Anders als in Deutschland fehlte in Japan eine gemeinsame besatzungspolitische Institution (Kontrollrat). Nicht zuletzt deshalb räumte der US-amerikanische Supreme-Court später ein, dass der IMTFE-Prozess weniger völkerstrafrechtlich gewirkt habe, sondern vor allem als Instrument politischer Machtausübung der USA.
Bald nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hatten die Völkerbundmitglieder ihre handlungsunfähig gewordene Organisation aufgelöst. An deren Stelle trat am 24. Oktober 1945 die Weltorganisation der Vereinten Nationen (United Nations Organisation/UNO). Ihre beiden wichtigsten Aufgaben sind: Sicherung des Weltfriedens bzw. der internationalen Sicherheit sowie internationale Zusammenarbeit ihrer Mitglieder als gleichberechtigte Staaten. Nach Art. 2 der Charta ist Gewaltanwendung ebenso verboten wie die Drohung mit Gewalt zwischen den Staaten. Im Anschluss an den Briand-Kellog-Pakt (1928) ist das „Recht auf Krieg“ lediglich als Reaktion auf die Gewaltanwendung eines anderen Staates zulässig. Dass die Vereinten Nationen aus der strukturellen Not, weder über eine verbindliche Methode noch über eine anerkannte Instanz friedlicher internationaler Streitschlichtung zu verfügen, eine optative Selbstverpflichtung gemacht haben, lässt Art 13, 1a der UN-Charta erkennen: „Die Generalversammlung veranlasst Untersuchungen und gibt Empfehlungen ab, um die internationale Zusammenarbeit auf politischem Gebiet zu fördern und die fortschreitende Entwicklung des Völkerrechts sowie seine Kodifizierung zu begünstigen.“ Maßgeblich dafür wurden in den kommenden Jahren der Rechtsausschuss der Generalversammlung und die Kodifikationskommission. Die lange Zeit des „Kalten Krieges“ und des West-Ost-Gegensatzes behinderte und verzögerte diese Entwicklung allerdings um Jahrzehnte.
Eine Neuorientierung leiteten erst Zäsuren ein, die im Übergang zu den 1990er Jahren fast gleichzeitig die bipolare Welt in eine multipolare zu verwandeln begannen: Mit den osteuropäischen Revolutionen Ende der 1980er Jahre und dem Wandel insbesondere der sowjetischen Außenpolitik wurden Voraussetzungen geschaffen, die seit Nürnberg erstmals nun auch institutionelle Veränderungen im Völkerstrafrecht erlaubten: Am 25.5.1993 beschloss der Sicherheitsrat (Res. 827) die Einsetzung des „Internationalen Strafgerichtshofes zur Verfolgung von Personen, die für die Begehung von schweren Verletzungen des humanitären Völkerrechts im ehemaligen Jugoslawien seit 1991 verantwortlich sind“ (ICTY), und am 8. November 1994 folgte der Beschluss (Res. 955) zur Einrichtung eines „Internationalen Strafgerichtshofs für die Verfolgung der Verantwortlichen für die im Hoheitsgebiet Ruandas oder von ruandischen Staatsangehörigen in Nachbarstaaten zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 194 begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht“ (ICTR). Ständiger Sitz des ICTY wurde Den Haag, Sitz des ICTR die Hauptstadt Tansanias, Arusha.
Schon in den 1980er Jahren hatte die Völkerrechtskommission (International Law Commission/ILC) ihre Arbeit wieder aufgenommen. Der amerikanisch-ägyptische Völkerstrafrechtsgelehrte Mahmoud Cherif Bassiouni legte die Fortschreibung seines Draft International Criminal Codes vor; aber erst 1992 folgte die Vollversammlung dem Vorschlag der ILC und erteilte ihr das Mandat, ein Statut für einen Internationalen Strafgerichtshof auszuarbeiten. Nach Vorlage eines Entwurfs und eines Berichts der ILC beschloss die Vollversammlung Anfang Dezember 1994, ein ad hoc-Komitee einzusetzen. In den 1990er hatten indes nicht nur die politischen und administrativen Initiativen für einen Ständigen Internationalen Strafgerichtshof zugenommen; auch die wissenschaftliche Diskussion war durch den ICTY und den ICTR belebt worden. Eine besondere Rolle spielte die Expertenkonferenz von Syrakus im Juni 1995. Neben den juristischen Experten meldeten sich nun auch die Vertreter von Menschenrechtsorganisationen zu Wort, insbesondere das Internationale Rote Kreuz und Amnesty International. Genannt werden müssen auch die Stellungnahmen des Europäischen Parlaments und der OSZE.
Am 18. Dezember 1995 beschloss die Vollversammlung, ein „Preparatory Commitee“ einzusetzen. Zwei Jahre später wurde das Angebot Italiens angenommen, eine Staatenkonferenz über die Errichtung eines Internationalen Strafgerichtshofes nach Rom einzuladen. Die Vollversammlung adressierte ihre Einladung nun auch an alle Nichtregierungsorganisationen; über zweihundert nahmen sie an. Last but not least wurde das Commitee auch beauftragt, einen völkerrechtlichen Vertrag vorzubereiten für die Gründung eines Internationalen Strafgerichtshofes (ICC), mit einem entsprechenden Gerichtsstatut.
Mitte Juni 1998 begann diese Konferenz, einen Monat später wurde sie abgeschlossen; am 17. Juli 1998 votierten in geheimer Abstimmung (bei 21 Enthaltungen) 120 Teilnehmerstaaten für und sieben (neben den USA wahrscheinlich China, Israel, Irak, Libyen, Jemen und Katar) gegen die Errichtung eines Internationalen Strafgerichtshofes. Diese „Konvention von Rom“ […] so das anspruchsvolle Urteil der Völkerrechtswissenschaft, „bildet die erste völkervertragliche Rechtsgrundlage eines internationalen Strafgerichtes und seiner Statut-Bestimmungen“ seit Nürnberg. (Ahlbrecht 1999, 360)
8. Würdigung
Die Bewertung des Nürnberger Prozesses und seiner Nachgeschichte muss das Augenmerk vor allem auf die beiden 1945/46 wohl wichtigsten nationalen Akteure richten, die Vereinigten Staaten und Deutschland. Stand dieses für bis dahin unbekannte Gewaltverbrechen, so verwirklichten die USA mit der Errichtung eines temporären Internationalen Strafgerichtshofs eine völkerrechtspolitische Vision. Der zivilisatorische Fortschritt, vor einem Weltgericht erstmals individuell verantwortliche Regierungschefs und Militärs wegen begangener Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen den Frieden und die Menschlichkeit angeklagt und verurteilt zu haben, war im Rückblick einer ersten internationalen Konferenz sechzig Jahre nach Nürnberg 2006 unstrittig.
Gefragt wurde – und wird, wie sich „nach Nürnberg“ das Interesse „an Nürnberg“ in den USA und Deutschland entwickelt hat. Der amerikanische Jurist und Menschenrechtsaktivist Raymond M. Brown sprach von einer mehrfachen „Ironie“ in dieser Entwicklung. Jenes Land, das sich nach 1945 kompromisslos und gegen den Widerstand der anderen Alliierten um die Fortentwicklung des Völkerstrafrechts bemüht hätte, habe diesen Prozess später bekämpft und zu verhindern versucht. Und was den USA in Nürnberg besonders wichtig gewesen war, die Ächtung des Angriffskrieges, sei bis heute trotz Art. 51 UN Charta umstritten. Der politische Einfluss, so das offizielle Credo der USA, beruhe nicht auf „internationalem Recht sondern auf militärischer Macht“. (Brown 2006, 21ff.)
Mit „Nürnberg“ war ein erstes umfassendes, völkerstrafrechtliches Kodifikationsprojekt realisiert. Ob, wann und wie die Staatengemeinschaft über „Nürnberg“ hinauskommen und einen ständigen internationalen Gerichtshof gründen würde, erschien spätestens seit den ausgehenden 1980er Jahren nur noch eine Frage der Zeit bzw. der politischen Mehrheitsverhältnisse in der Vollversammlung. Inzwischen hatte sich die Interessenlage im Verhältnis der ungleichen Nürnberger Akteure abermals verändert. Der vormalige Sieger, Ankläger und Richter, die USA, mochte diese Rolle in der multipolaren Welt nicht mehr spielen. Als militärische Supermacht zu einer Art „Weltpolizist“ mutiert, waren und sind Regierung und Bevölkerung der Vereinigten Staaten nicht bereit, mit dem ICC eine UN-Institution zu unterstützen, vor der US-Soldaten und damit das globale militärische Engagement der Vereinigten Staaten angeklagt werden können.
Auch das einst von der Weltmeinung geächtete Deutschland hat seine Lektion in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts gelernt, wenn auch andere Konsequenzen aus diesem Lernprozess gezogen. Die Rückkehr zum demokratisch legitimierten Rechtsstaat und die in ihn eingebettete westeuropäisch-atlantische Bündnispolitik haben nicht nur zur baldigen Wiederaufnahme der Bundesrepublik in die internationale Staatengemeinschaft geführt. Dass sich Deutschland zusammen mit Australien, Kanada und anderen Ländern in den 1990er Jahren als gerichtshoffreundlicher Staat profilieren konnte, hat ihm im Kampf um Gründung und Aufbau des ersten (ständigen) Internationalen Strafgerichtshofs Ansehen und Einfluss eingebracht. Dass es zugleich seine bündnispolitisch immer wieder eingeforderten militärischen und humanitären Aufgaben internationaler Friedenssicherung nur zögerlich wahrnimmt, relativiert dieses Image verständlicherweise.
Auch auf der genannten ersten internationalen Bewertungskonferenz sollte die historische Bedeutung des IMT durch den keineswegs neuen Vorwurf relativiert werden, dass Nürnberg versäumt habe, den Opfern der Verbrechen Gesicht und Stimme zu geben. Ein fragwürdiger und m.E. ganz unverhältnismäßiger, weil aus der Nachgeschichte abgeleiteter Vorwurf. Zu fragen ist doch: Was wollte, was konnte und musste der Nürnberger Prozess unmittelbar nach dem Kriege leisten? In einer Welt, die – Deutschland eingeschlossen – bestenfalls oberflächliche Kenntnis hatte von den Gewaltverbrechen des Zweiten Weltkrieges; in einer Welt, in der die siegreichen Alliierten bezüglich eines ad hoc-Gerichtshofs uneins waren und sehr unterschiedliche Interessen verfolgten. Großbritannien musste von den Exilregierungen gedrängt werden. Frankreich hatte unter den drei Großen keine einflussreiche Stimme. Die Sowjetunion aber konnte mit 20 Millionen Zivilisten nicht nur die meisten Opfer zu beklagen, sie hatte auch ein großes Interesse daran, vor der Weltöffentlichkeit die Millionen Toten aus Stalins Massenverbrechen zu verbergen.
Das Gericht stand unter großem Zeitdruck und musste im schwer zerstörten Deutschland unter extrem schwierigen Bedingungen agieren. Hätten die US-Amerikaner dafür nicht umfangreiche personelle und technische Ressourcen eingesetzt – und hätte ihnen mit Robert H. Jackson als Chef-Ankläger nicht ein politisch begabter Jurist von großen Qualitäten zur Verfügung gestanden, kaum vorstellbar, dass das Gericht gegen so viele verantwortliche Personen aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Lebensbereichen hätte Anklage erheben und die vorgeworfenen Verbrechen mit schriftlichen Zeugnissen glaubhaft dokumentieren können. Den Opfern konnte in diesem Augenblick nicht die gleiche Aufmerksamkeit zuteilwerden. Der Judenmord, die Shoah, der Holocaust war durchaus ein zentrales Thema in Nürnberg, aber notwendigerweise mussten zunächst die Organisatoren und Exekutoren des Verbrechens im Mittelpunkt stehen und nicht die Opfer.
So war Robert H. Jackson ein Glücksfall der Geschichte. Seiner Persönlichkeit, seinen Überzeugungen und seiner Willenskraft ist es ganz wesentlich zu verdanken, dass den angeklagten deutschen Tätern ein fairer Prozess gemacht und dass eine erste umfassende Dokumentation der deutschen Gewaltverbrechen erarbeitet wurde. Nach der Verabschiedung des Londoner IMT-Statuts empfing Truman Jackson im Weißen Haus und notierte in seinem Kalender: „One good man“. (Barrett 2006, 129ff.)
9. Quellen/Literatur/Anmerkungen
Veröffentlichte Quellen
Gilbert, G. M.: Nürnberger Tagebuch, Gespräche der Angeklagten mit dem Gerichtspsychologen, Frankfurt/Main 14. Aufl. 2012.
(IMT) Internationaler Militärgerichtshof (Hg.): Der Nürnberger Prozess, 12 Bde, Nachdruck Nürnberg 1947ff.
Overy, R.: Verhöre, Die NS-Elite in den Händen der Alliierten 1945, Berlin 2005.
Literatur
Ahlbrecht, H.: Geschichte der völkerrechtlichen Strafgerichtsbarkeit im 20.Jahrhundert, Baden Ba
den 1999.
Barret, J. Q.: „One Good Man”. The Jacksonian Shape of Nuremberg, in: Reginbogin/Safferling:
Nürnberger Prozesse, Berlin 2006, 129–138.
Benz, W.: Dimension des Völkermords, Die Zahl der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus,
München 1991.
Bloxham, D.: Genocide on Trial, War Crimes Trials and the Formation of Holocaust History and
Memory, Oxford 2001.
Bloxham, D.: „Nürnberg“ als Prozess, IMT, NMT und institutionelle Lerneffekte. In: Priemel/Stiller,
NMT, Hamburg 2013, 493–524.
Brandt, W.: Verbrecher und andere Deutsche, Ein Bericht aus Deutschland 1946, Bonn 2007.
Delbrück, J. / Wolfrum, R.: Völkerrecht, Begründet von Georg Dahm, Band I/3, Berlin 2002.
Fest, J. C.: Das Gesicht des Dritten Reiches. Profile einer totalitären Herrschaft, München 1980.
Hankel, G.: Die Leipziger Prozesse, Deutsche Kriegsverbrechen und ihre strafrechtliche Verfolgung
nach dem Ersten Weltkrieg, Hamburg 2003.
Heinemann, U.: Die verdrängte Niederlage, Politische Öffentlichkeit und Kriegsschuldfrage in der
Weimarer Republik, Göttingen 1983.
Hilger, A.: Die Gerechtigkeit nehme ihren Lauf. In: Norbert, F.: (Hg.): Transnationale Vergangen
heitspolitik. Der Umgang mit deutschen Kriegsverbrechern in Europa nach dem Zweiten Welt
krieg, Göttingen 2006, 180–146
Huneke, D. K.: The Moses of Rovno, The Stirring Story of Fritz Graebe, a German Christian Who
Risked His Life to Lead Hundreds of Jews to Safety During the Holocaust, New York 1985.
Jackson, R. H.: Staat und Moral, Zum Werden eines neuen Völkerrechts, München 1946.
Kastner, K.: Die Völker klagen an, Der Nürnberger Prozess 1945–1946, Darmstadt 2005.
Kempner, R. M.W.: Ankläger einer Epoche. Lebenserinnerungen, In Zusammenarbeit mit Jörg
Friedrich, Frankfurt/Main und Berlin 1986.
Klessmann,C.: Der Generalgouverneur Hans Frank, in: VfZ 19(1971), Heft 3, 245–260.
Kochavi, A. J.: Prelude to Nuremberg, Allied war crimes policy and the question of punishment,
Chapel Hill and London 1998.
Krösche, H.: Nürnberg und kein Interesse, Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher 1945/46
und die Nürnberger Nachkriegsöffentlichkeit, in: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der
Stadt Nürnberg 93. Band, Nürnberg 2006, S. 299–317.
Lippe, V. Frhr. v.d.: Nürnberger Tagebuchnotizen, November 1945 bis Oktober 1946, Frank
furt/Main 1951.
Mai, G.: Der Alliierte Kontrollrat in Deutschland 1945–1948, Alliierte Einheit – deutsche Teilung,
München 1995.
Oberndörfer, R.: Recht und Richter, Verfahrensrechtliche Aspekte der Nürnberger Prozesse, in:
Priemel, K. /Stiller, A.: NMT, Hamburg 2013, 525–545.
Priemel, K. C. / Stiller, A.: NMT, Die Nürnberger Militärtribunale zwischen Geschichte,
Gerechtigkeit und Rechtschöpfung, Hamburg 2013.
Radlmeier, S.: Der Nürnberger Lernprozeß, Von Kriegsverbrechern und Starreportern, Frank
furt/Main 2001.
Reichel, P.: Der Nationalsozialismus vor Gericht und die Rückkehr zum Rechtsstaat, in: Rei
chel/Schmid/Steinbach (Hg.): Der Nationalsozialismus. Die zweite Geschichte, Überwindung –
Deutung – Erinnerung, München 2009, 22–61.
Reichel, Peter 2007 (Neuaufl.): Vergangenheitsbewältigung in Deutschland. Die Auseinanderset
zung mit der NS-Diktatur in Politik und Justiz, München
Reginbogin, H. R. / Safferling, C. J. M. (Hg.): Die Nürnberger Prozesse, Völkerstrafrecht seit 1945,
München 2006.
Rückerl, A.: NS-Verbrechen vor Gericht, Versuch einer Vergangenheitsbewältigung, Heidelberg
1982.
Seliger, H.: Politische Anwälte, Die Verteidiger der Nürnberger Prozesse, München 2016.
Smith, B. F.: Der Jahrhundertprozeß, Die Motive der Richter von Nürnberg – Anatomie einer
Urteilsfindung, Frankfurt/Main 1979.
Smith, B. F.: The Road to Nuremberg, New York 1982.
Sowade, H.: Nonkonformist, SS-Führer und Wirtschaftsfunktionär, in: Smelser, R. / Syring, E. /
Zitelmann, R. (Hg.): Die braune Elite, Bd. 1: Biographische Skizzen, Darmstadt 1999, 188–220.
Taylor, T.: Die Nürnberger Prozesse, Hintergründe, Analysen und Erkenntnisse aus heutiger
Sicht, München 1994.
Ueberschär, G. R.: Der Nationalsozialismus vor Gericht, Die alliierten Prozesse gegen Kriegsver
brecher und Soldaten 1943–1952, Frankfurt/Main 1999.
von der Lippe, V.: Nürnberger Tagebuchnotizen, November 1945 bis Oktober 1946, Frank
furt/Main 1951.
von Medem, G.: Axel von dem Bussche, Mainz 1994.
Weinke, A.: Die Nürnberger Prozesse, 2. Auflage München 2015.
Werle, G., Jessberger, F.: Völkerstrafrecht, 5. Auflage Tübingen 2020.
Peter Reichel
Februar 2020
Peter Reichel ist Professor für Politische Wissenschaften im Ruhestand. Von 1983 bis 2007 lehrte er Historische Grundlagen am Institut für Politikwissenschaft der Universität Hamburg. Er lebt als freier Autor in Berlin. Zahlreiche Veröffentlichungen zur deutschen Geschichte und Gesellschaft, insbesondere zur politischen Kulturgeschichte Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert, unter anderem: «Politik mit der Erinnerung. Gedächtnisorte im Streit um die nationalsozialistische Vergangenheit» (2. Aufl. 1999), «Schwarz-Rot-Gold. Kleine Geschichte deutscher Nationalsymbole nach 1945» (2005) und zuletzt «Der tragische Kanzler: Hermann Müller und die SPD in der Weimarer Republik» (2018).
Zitierempfehlung:
Reichel, Peter: „Der internationale Militärgerichtshof gegen Hermann Göring u.a., Deutschland 1945/1946“, in: Groenewold/ Ignor / Koch (Hrsg.), Lexikon der Politischen Strafprozesse, https://www.lexikon-der-politischen-strafprozesse.de/glossar/goehring-u‑a/, letzter Zugriff am TT.MM.JJJJ.