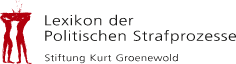Deutschland 2013–2018
Nationalsozialistischer Untergrund
Sprengstoffanschlag
Mord
![]() Download
Download
Der NSU-Prozess
Deutschland 2013–2018
1. Prozessbedeutung/Prozessgeschichte
Genauso wie Auschwitz- und Stammheim-Verfahren gehört der NSU-Prozess zu den großen Strafprozessen in der Bundesrepublik Deutschland des 20. Jahrhunderts. „NSU“ steht als Kürzel für jene Bezeichnung, die sich die rechtsterroristische Gruppe Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe selbst gegeben hatte: „Nationalsozialistischer Untergrund“. Zehn Menschen ermordete diese Gruppe zwischen den Jahren 1998 und 2011, darunter neun Männer aus Familien mit Migrationshintergrund. Sie verübte drei Bombenanschläge und 15 Raubüberfälle, ohne dass der rechtsextreme Hintergrund der Taten zunächst bekannt wurde (Quent, S. 15). Im Jahre 2011 töteten Mundlos und Böhnhardt sich nach einem Raubüberfall und nach ihrer Entdeckung durch die Polizei in einem Wohnmobil in Eisenach. Beate Zschäpe setzte daraufhin die Zwickauer Untergrundwohnung des Trios in Brand und stelle sich vier Tage später den Behörden (Schultz, S. 9).
Die Hauptverhandlung fand vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts München (6. Strafsenat) unter Vorsitz von Richter Manfred Götzl statt und erstreckte sich über einen Zeitraum von fünf Jahren mit 438 Verhandlungstagen. Die Verhandlung begann am 6. Mai 2013 und endete mit der mündlichen Urteilsverkündung am 11. Juli 2018. Das schriftliche Urteil wurde am 21. April 2020 fertiggestellt. Vor Gericht stand die Hauptangeklagte Beate Zschäpe, die als einzige Überlebende angeklagt war. Mit angeklagt waren Ralf Wohlleben, Carsten Schultze, André Eminger sowie Holger Gerlach. Ihnen warf die Bundesanwaltschaft Handlungen zur Unterstützung der Verbrechen des NSU vor. Die fünf Angeklagten wurden laut Aufzählung im Urteil von insgesamt 33 Verteidigern, freilich in unterschiedlicher Länge und Prozessrolle hinsichtlich ihres Agierens (wozu wohl auch kurzzeitige Beiordnungen gehörten), vertreten. 95 Nebenkläger mit 60 Anwälten waren am Prozess beteiligt, in dem mehr als 600 Zeugen sowie Sachverständige gehört wurden. Der Senat entschied während des Verfahrens über 264 Beweis und 43 Befangenheitsanträge. Letztere wurden allesamt abschlägig beschieden.
Beate Zschäpe legte Revision gegen ihre Verurteilung zum Bundesgerichtshof ein. Ein Gleiches tat André Eminger und in seinem Fall auch die Bundesanwaltschaft. Nachdem der BGH die Revision von Zschäpe im Wesentlichen (unter geringfügiger Abänderung des Schuldspruchs) verworfen hatte, legte Zschäpe Verfassungsbeschwerde ein (siehe näher unten 8.).
Der gesamte Prozess wurde von einer Reihe schwieriger Fragen und Probleme geprägt. Es begann mit dem fehlgeschlagenen Akkreditierungsverfahren der Journalisten, in welches das BVerfG eingreifen und das OLG dazu veranlassen musste, nicht das sog. Windhundverfahren („wer zuerst kommt“) anzuwenden, sondern durch Los über die für Medienvertreter im Gerichtssaal nicht ausreichend vorhandenen Plätze zu entscheiden. Zu Beginn des Verfahrens beantragte die Verteidigung eine Tonbandaufzeichnung mit Verweis auf die Frankfurter Auschwitzprozesse und die Strafverfahren gegen die Mitglieder der RAF, und dies schon aus historischem Interesse. Der Antrag wurde abgelehnt. Dasselbe geschah mit dem Antrag, die Hauptverhandlung in einen Nebenraum zu übertragen (Friedrichsen, Prozess, S. 21 ff.).
Die Verteidigung von Zschäpe beantragte ferner am 3. Verhandlungstag, die Hauptverhandlung in Bild und Ton, hilfsweise allein akustisch aufzuzeichnen. Eine Nebenklägervertreterin begehrte ebenfalls eine Audioaufzeichnung. Dem trat die Bundesanwaltschaft entgegen; es sei gesetzlich nicht vorgesehen. Die Zeugen sollten unbefangen aussagen, nicht eingeschüchtert durch eine Drohkulisse. Eine andere Nebenklägervertreterin wies auf die Aufzeichnungspraxis des Internationalen Gerichtshofes in Den Haag hin; die Verteidigung von Carsten Schultze betonte die Praxis des OLG Düsseldorf, das Verhandlungen aufzeichne (Ramelsberger, Bd. I, S. 13). Alle Anträge zur Aufzeichnung der Hauptverhandlung wurden dennoch durch das Gericht abgelehnt.
Bevor die Plädoyers vorgetragen wurden, hatte die Verteidigung erneut beantragt, den Schlussvortrag der Bundesanwaltschaft akustisch aufzuzeichnen und die Datenträger an die Verfahrensbeteiligten auszuhändigen, zumindest aber zu gestatten, zur ausschließlich internen Verwendung selbst aufzuzeichnen. Hilfsweise wurde begehrt, die Bundesanwaltschaft zu ersuchen, ihre Manuskripte zu überlassen oder die Möglichkeit einzuräumen, Stenotypisten hinzuzuziehen. Alle diese Anträge scheiterten. Der Vorsitzende Götzl wies in seiner Begründung auch das Argument der Verteidigung zurück, die Angeklagten seien ohne Tonaufnahme nicht mehr verhandlungsfähig. Es genüge, wenn Angeklagte ihre Interessen wahrnehmen könnten. Dies bedeute nicht, dass sie dies in jeder Hinsicht selbstständig und ohne Hilfe tun können müssten. Die Grenze müsse erst dort gezogen werden, wo die Entscheidung über grundlegende Fragen der Verteidigung nicht mehr möglich sei (https://www.nsu-watch.info/2017/07/protokoll-375-verhandlungstag-25-juli-2017/- zuletzt aufgerufen: 13.4.2023).
Dass der inhaltliche Gang der Hauptverhandlung trotz der nicht vorhandenen prozessrechtlichen Möglichkeit eines Inhaltsprotokolls heute dennoch nachverfolgt werden kann, ist den Mitschriften von Journalisten und Prozessbeobachtern zu verdanken. So liegt die fünfbändige Ausgabe „Der NSU-Prozess – Das Protokoll“ vor. Dabei handelt es sich um die Veröffentlichung der akribischen Mitschriften des Ablaufs der einzelnen Verhandlungstage durch die Journalistinnen und Journalisten Annette Ramelsberger, Wiebke Ramm, Tanjev Schultz und Rainer Stadler. Ferner sind die detaillierten Protokolle der einzelnen Verhandlungstage durch die Betreiber der Plattform NSU-Watch dokumentiert. In komprimierter Form gibt über den Prozessverlauf Gisela Friedrichsen mit ihrem Buch „Der Prozess. Der Staat gegen Beate Zschäpe u.a.“ Aufschluss. Als eine Lehre aus dem NSU-Prozess hat der Gesetzgeber 2017 mit der Neueinfügung von § 169 Abs. 2 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) eine Rechtsgrundlage für die Tonaufnahme von Gerichtsverhandlungen geschaffen. Diese können nun zu wissenschaftlichen und historischen Zwecken vom Gericht zugelassen werden, wenn es sich um ein Verfahren von herausragender zeitgeschichtlicher Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland handelt.
Am 22.11.2022 legte das Bundesministerium der Justiz zudem den Referentenentwurf eines
„Hauptverhandlungsdokumentationsgesetzes“ vor. Danach sollen die Länder die Aufzeichnung der Hauptverhandlungen vor Land- und Oberlandesgerichten in Bild und Ton zunächst freiwillig und schrittweise einführen können, bevor dies ab dem 1. Januar 2030 bundesweit verbindlich gelten soll (Kaufmann; siehe dazu näher unten 9.).
In dem am 11. Juli 2018 verkündeten Urteil wurde Zschäpe u.a. als Mittäterin der Morde, Anschläge und Raubüberfälle sowie wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld verurteilt. Die Angeklagten Eminger und Gerlach wurden der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung schuldig gesprochen; Eminger erhielt eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten, Gerlach eine solche von drei Jahren. Die Angeklagten Wohlleben und Schultze wurden wegen Beihilfe zu mehreren Fällen des Mordes verurteilt, der Angeklagte Wohlleben zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren, der Angeklagte Schultze zu einer Jugendstrafe von drei Jahren (siehe näher unten 7.).
2. Personen
a) Die Angeklagten
Beate Zschäpe wurde am 2. Januar 1975 in Jena nichtehelich geboren. Ihre Mutter hatte den Kindesvater im Rahmen eines Aufenthalts in Rumänien kennengelernt. Der Vater erkannte die Vaterschaft indessen nie an und hatte bis zu seinem Tod keinen Kontakt zur Tochter. Beate Zschäpe wurde zunächst von den Großeltern mütterlicherseits in Jena betreut, da die Mutter bis Mitte 1975 ihr Studium in Rumänien fortsetzte. Danach lebte sie zum Teil zusammen mit ihrer Mutter und deren wechselnden Partnern, wurde mit ihrem dritten Lebensjahr aber wieder von den Großeltern betreut. Lediglich die Wochenenden verbrachte sie bei ihrer Mutter und deren damaligem Ehemann. Von 1979 bis 1996 lebten die Mutter und Beate Zschäpe gemeinsam in Jena. Ihre letzte Wohnung wurde 1996 zwangsgeräumt, weil die Mutter die Miete nicht mehr bezahlte. Übergangsweise wohnte Beate Zschäpe zunächst wieder bei ihrer Großmutter und zog dann im Herbst 1996 in die Wohnung der Familie ihres damaligen Freundes Uwe Böhnhardt. Von Januar 1997 an lebte sie in ihrer ersten eigenen Wohnung in Jena, die sie bis zur Flucht im Januar 1998 nutzte.
Beate Zschäpe verfügt über einen schulischen Abschluss der 10. Klasse. Danach konnte sie jedoch keinen Ausbildungsplatz in ihrem Wunschberuf Kindergärtnerin finden. Sie arbeitete einige Monate als Malergehilfin und begann danach eine Ausbildung zur Gärtnerin für den Gemüseanbau. Trotz dieser Fachrichtung der Ausbildung hoffte sie, sie könne sich in dem Lehrberuf kreativ, im Sinne einer künstlerisch-floristischen Tätigkeit, mit Blumen betätigen. Dies war aber zu ihrer Enttäuschung in der Praxis nicht der Fall, weil sie entsprechend der Fachrichtung Gemüseanbau hauptsächlich mit Feldarbeit und Arbeiten im Gewächshaus betraut wurde. Die Ausbildung schloss sie 1995 mit einem “befriedigenden” Ergebnis ab. Eine Arbeitsstelle in ihrem erlernten Beruf fand sie freilich nicht, sondern war ein Jahr lang im Rahmen einer ABM-Maßnahme erneut als Malerhelferin tätig. In der gesamten Phase der Flucht (1998–2011) ging sie keiner entgeltlichen Tätigkeit mehr nach.
Im Alter von etwa 15 Jahren lernte Beate Zschäpe ihren ersten Freund kennen, der von Diebstählen lebte, an denen sie sich beteiligte. Nach der Trennung von diesem Freund ging sie eine Beziehung mit Uwe Mundlos ein, den sie schon länger aus der „Clique“ in ihrem Wohngebiet kannte. An ihrem 19. Geburtstag lernte sie Uwe Böhnhardt kennen und verliebte sich in ihn. Von Uwe Mundlos, der 1994 zur Bundeswehr ging, trennte sie sich, blieb ihm aber freundschaftlich verbunden. Die Beziehung mit Uwe Böhnhardt bestand bis zu seinem Tod.
Das Verhältnis von Beate Zschäpe zu ihrer Mutter verschlechterte sich aufgrund von deren persönlichen Problemen zunehmend. Die Mutter hatte ihren Arbeitsplatz verloren und verhielt sich zunehmend passiv. Zudem steigerte sie ihren Alkoholkonsum auf ein problematisches Niveau. Mit dem neuen Partner der Mutter, mit dem diese aber nicht zusammenlebte, verstand sich Beate Zschäpe nicht. Dazu kam noch der Umstand, dass sie mit ihrer eigenen beruflichen Situation höchst unzufrieden war. Der endgültige Bruch mit der Mutter erfolgte nach der Zwangsräumung der Wohnung. Zur Großmutter hingegen behielt Beate Zschäpe bis zu ihrer Flucht ein sehr gutes und inniges Verhältnis. Im Zeitraum der Flucht von Januar 1998 bis November 2011 bestand aber weder ein persönlicher noch ein sonstiger Kontakt von Beate Zschäpe zu Mutter und Großmutter. Beate Zschäpe wurde am 8. November 2011 vorläufig festgenommen und befand sich danach während des gesamten Verfahrens in Untersuchungshaft. Sie war bislang nicht vorbestraft.
Der Angeklagte André Eminger wurde am 1. August 1979 in Erlabrunn in Thüringen geboren. Er ist verheiratet und hat mit seiner Ehefrau drei gemeinsame Kinder. Eminger hat noch einen älteren Bruder sowie eine Schwester und verbrachte seine Kindheit in Johanngeorgenstadt. 2005 zog er nach Zwickau, wo er bis zu seiner Festnahme im November 2011 lebte. Eminger besuchte die zehnklassige allgemeinbildende polytechnische Oberschule in Johanngeorgenstadt und danach dort das Gymnasium, welches er wegen ungenügender Leistungen verlassen musste. Er erlangte die Mittlere Reife und schloss nach Beendigung der Schulzeit eine Maurerlehre erfolgreich ab. Die folgenden Jahre waren geprägt von der Tätigkeit als Maurer und der Ableistung des Grundwehrdienstes, aber auch von Arbeitslosigkeit. Danach führte er eine erfolgreiche Umschulungsmaßnahme zum Fachinformatiker durch, wurde erneut arbeitslos, qualifizierte sich jedoch zum Berufskraftfahrer und fand schließlich Anstellungen als Fernverkehrsfahrer bei verschiedenen Speditionen. In der Folge machte er sich selbständig und meldete in Zwickau ein Gewerbe an, das verschiedene Tätigkeiten umfasste, vom Handelsvertreter bis zum Veranstaltungsservice. Dieses Gewerbe meldete er kurze Zeit später wieder ab und war erneut als Berufskraftfahrer beschäftigt, um danach ein ähnliches Gewerbe anzumelden, das er schon ausgeübt hatte. Nach einem Arbeitsunfall wurde Eminger arbeitslos. Das war er auch noch bei seiner Verhaftung am 4. November 2011. Der Haftbefehl des Ermittlungsrichters des BGH vom 23. November 2011 wurde am 14. Juni 2012 aufgehoben. Am 372. Sitzungstag, dem 12. September 2017, ordnete der Strafsenat jedoch erneut die Untersuchungshaft an, die sofort vollzogen wurde. Eminger befand sich sodann bis zur Urteilsverkündung am 11. Juli 2018 in Untersuchungshaft. Mit der Urteilsverkündung wurde der Haftbefehl aufgehoben. Eminger war bis dahin unbestraft gewesen.
Holger Gerlach wurde am 14. Mai 1974 in Jena geboren. Er ist ledig, lebt aber seit 2007 in einer stabilen Partnerschaft. Seine Mutter war alleinerziehend. Gerlach hat zwei ältere Geschwister. Zu seinem Vater bestand keine Beziehung, weil dieser die Kinder nicht gewollt hatte. Der Vater beging in den neunziger Jahren Suizid. Der Stiefvater verstarb 1986 auf Grund eines Herzinfarkts.
Gerlach besuchte die allgemeinbildende polytechnische Oberschule, von der er wegen groben Fehlverhaltens verwiesen wurde. Danach absolvierte er eine Lehre zum Zerspanungsmechaniker, wurde aber nach der Ausbildung sogleich arbeitslos. Durch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme war er in der Jugendwerkstatt Jena als Maler tätig, erzielte aber 1997 den Abschluss als Qualitätsfachmann. Wegen höherer Chancen, Arbeit zu finden, zogen er und seine Mutter zum älteren Bruder von Gerlach nach Hannover. Dort war Gerlach 15 Jahre Lagerist und später bei dieser Tätigkeit Schichtführer und Betriebsratsmitglied. Wegen einer Spielsucht befand er sich in therapeutischer Behandlung. Er war ebenfalls nicht vorbestraft.
Gerlach wurde am 13. November 2011 vorläufig festgenommen und verblieb aufgrund eines Haftbefehls des Ermittlungsrichters des BGH bis zum 25. Mai 2012 in Untersuchungshaft.
Ralf Wohlleben wurde am 27. Februar 1975 geboren. Er wuchs mit einer jüngeren Schwester in der elterlichen Familie in Jena auf. Das Verhältnis zu seinen Eltern war unproblematisch, wobei er die Erziehung durch sie als streng empfand. Von 1981 bis 1991 besuchte er die Schule, die er mit dem qualifizierten Hauptschulabschluss abschloss. 1991/92 absolvierte er ein Berufsvorbereitungsjahr im Bereich Holzverarbeitung in Jena. Zuhause gehörte Hausarrest bei Zuspätkommen zu den üblichen Strafen. Im Jahr 1992 riss der Angeklagte deswegen aus. Er fuhr mit mehreren Personen aus seiner Jugendclique mit dem Zug nach Gera, wo sie zwei Autos entwendeten und zurück nach Jena fuhren. Als die Polizei sie stellen wollte, gelang ihnen die Flucht. Sie fuhren nach Österreich und wurden dort von der Polizei aufgegriffen. Wohlleben kam in ein Jugendheim in Gera und erhielt dort eine Tischlerausbildung. Mit Einverständnis seiner Eltern und des Jugendamts blieb er dort bis 1993. Anschließend wohnte er wieder bei seinen Eltern in Jena. Eine Ausbildung zum Verkäufer brach er 1994 nach weniger als einem halben Jahr ab. Danach arbeitete er als Gebäudereiniger in Jena und im Jahr 1995 in einer Druckerei. Von 1996 bis 1998 erhielt Wohlleben eine Ausbildung zum Handelsfachpacker. Ab April 1999 war er als Verkaufsberater bei einem Möbelfachmarkt beschäftigt. In der Folgezeit entwickelte er ein Interesse für Computer und EDV und begann im August 2001 eine Umschulung zum Fachinformatiker, die er 2003 erfolgreich abschloss. Danach war er bis 2007 arbeitslos. Während dieser Zeit absolvierte er mehrere Weiterbildungsmaßnahmen. Seit 1. Oktober 2007 bis zu seiner Verhaftung 2011 arbeitete er als Feinelektroniker.
Im Jahre 2002 lernte Wohlleben seine spätere Frau kennen, die er 2005 heiratete. Das Ehepaar lebte in Jena und hat zwei gemeinsame Töchter, die in den Jahren 2004 und 2006 geboren wurden. Ralf Wohlleben ist nicht vorbestraft; auf Grund des Haftbefehls des Ermittlungsrichters des BGH vom 28. November 2011 befand er sich während des gesamten Verfahrens in Untersuchungshaft.
Carsten Schultze wurde am 6. Februar 1980 in Neu-Delhi geboren, wo sein Vater für den VEB Carl-Zeiss-Jena tätig war. Aufgrund einer Psychose und schwerer Depression der Mutter musste die Familie in die DDR zurückkehren. Seinen Vater nahm Schultze als sehr streng wahr. Schultze beendete 1996 die Schule mit der mittleren Reife. In Springe (Landkreis Hannover) begann er eine Lehre als Konditor, wurde aber nach drei Monaten von den Eltern gegen seinen Willen zurück nach Thüringen geholt. Der Vater hatte für die Homosexualität seines Sohnes keinerlei Verständnis. Schultze wurde auch in der Schule von Mitschülern gemobbt. Es folgte eine Ausbildung zum Kfz-Lackierer. Im Sommer 2000, noch in Jena, hatte Carsten Schultze sein Coming-out. Er holte das Fachabitur nach und ging 2003 nach Düsseldorf, um Sozialpädagogik zu studieren. 2007 erhielt er sein Diplom. Bis zu seiner Verhaftung arbeitete Schultze in Düsseldorf bei der Aidshilfe und in einem schwul-lesbischen Jugendprojekt.
Während seiner Ausbildung in Jena fand er mehr und mehr Anschluss in der rechten Szene und lernte dabei auch Ralf Wohlleben kennen. 1999 wurde er stellvertretender Vorsitzender des NPD-Kreisverbandes Jena unter Wohlleben, 2000 stellvertretender Bundesgeschäftsführer der Jugendorganisation der NPD (JN) und kurz darauf stellvertretender JN-Vorsitzender in Thüringen. Im September 2000 stieg Schultze wegen seiner homosexuellen Veranlagung aus der rechten Szene aus und legte alle Ämter nieder.
Carsten Schultze ist nicht vorbestraft. Er befand sich auf Grund des Haftbefehls des Ermittlungsrichters des BGH vom 31. Januar 2012 bis zu dessen Aufhebung am 29. Mai 2012 in Untersuchungshaft.
b) Die Verteidiger
An dem Prozess wirkten laut Urteil 33 Strafverteidiger und zwei Strafverteidigerinnen mit. Eine große Zahl davon ist aber offensichtlich nur in sehr geringem Umfang tätig geworden und wieder ausgeschieden (siehe schon oben 1.). Übrig bleiben wohl 14 Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger, die als die eigentlichen Akteure der Strafverteidigung angesehen werden können.
Die Angeklagte Zschäpe wurde zunächst von den Rechtsanwälten Wolfgang Heer (Köln) und Wolfgang Stahl (Koblenz) sowie von Rechtsanwältin Anja Sturm (Berlin, dann Köln) verteidigt. Später kamen die Anwälte Mathias Grasel und Hermann Borchert (beide München) hinzu. Die Verteidigung von André Eminger oblag den Rechtsanwälten Michael Kaiser und Herbert Hedrich (beide Berlin), kurzzeitig auch den Rechtsanwälten Daniel Sprafke (Karlsruhe) und Björn Clemens (Düsseldorf). Die Rechtsanwälte Nicole Schneiders (Reutlingen) und Olaf Klemke (Cottbus) verteidigten den Angeklagten Wohlleben, später wurde dieses Duo durch Rechtsanwalt Wolfram Nahrath (Berlin) ergänzt. Der Angeklagte Carsten Schultze wurde von Rechtsanwalt Jacob Hösl (Köln) und von Rechtsanwalt Johannes Pausch (Düsseldorf) verteidigt, der Angeklagte Gerlach von den Rechtsanwälten Stefan Hachmeister und Pajam Rokni-Yazdi (beide Hannover).
Mit Ausnahme von Rechtswalt Borchert (für Zschäpe) waren alle Genannten Pflichtverteidiger. Wahlverteidiger waren ferner kurzzeitig die Rechtsanwälte Daniel Sprafke sowie Björn Clemens, denen der Senat die Pflichtverteidigung neben den bereits bestellten Verteidigern Emingers verweigerte.
c) Das Gericht
Der Prozess fand vor dem 6. Strafsenat (dem Staatsschutzsenat) des Oberlandesgerichts München unter Vorsitz des Richters Manfred Götzl statt. Zur Besetzung des Senats gehörten weiter die Richter am Oberlandesgericht Peter Lang und Konstantin Kuchenbauer sowie die Richterinnen am Oberlandesgericht Michaele Odersky und Dr. Renate Fischer, ferner die zwei Ergänzungsrichter Peter Prechsl und Axel Kramer sowie die Ergänzungsrichterin Gabriele Feistkorn.
Dieses Gericht in München war zuständig, weil der Prozess in einem der Bundesländer stattfinden musste, in denen die Taten des NSU begangen wurden. In Bayern hatte der NSU fünf der insgesamt zehn Morde verübt. Da die Anklage u.a. wegen § 129 a StGB (Bildung terroristischer Vereinigungen) erhoben worden war, musste der Prozess an einem Staatsschutzsenat stattfinden, den es in Bayern allein in München gibt (Greif/Schmidt, 154, Fn. 542).
d) Die Staatsanwaltschaft
Die Anklage war durch den Generalbundesanwalt (GBA) erhoben worden. Im Prozess wurde sie vertreten durch Bundesanwalt Herbert Diemer, Oberstaatsanwältin Anette Greger, Oberstaatsanwalt Jochen Weingarten sowie Staatsanwalt Stefan Schmidt. Aufgrund der Anklageerhebung beim Staatsschutzsenat des OLG München übte der GBA im Wege der „Organleihe“ (Art. 96 Abs. 5 GG) Bundesgerichtsbarkeit aus (§ 120 Abs. 6 GVG).
3. Zeitgeschichtliche Einordnung mit Vorgeschichte
Der Strafprozess gegen Beate Zschäpe und die angeklagten Unterstützer der terroristischen Vereinigung steht für die Bemühungen des Staates, Rechtsterrorismus mit den Mitteln des Strafrechts zu begegnen (nachfolgend Arnold, FS Sancinetti, 37).
Rassismus und Rechtsradikalismus, wozu auch Rechtsterrorismus gehört, sind in der Bundesrepublik Deutschland verbreitete und im Erstarken begriffene gesellschaftliche Phänomene. Für die Bundesrepublik Deutschland herrscht keine Einigkeit darüber, ob in den Jahren von 1990 bis 2015 insgesamt 75 oder 184 Menschen Todesopfer von rechter Gewalt geworden sind. Zwischen den Jahren 2015 und 2018 sind nach einer Statistik weitere 194 Todesopfer rechter Gewalt zu beklagen gewesen. Eingeschätzt wird, dass die tödliche Gewalt aus der rechtsextremen Bewegung in den allermeisten Fällen vigilantistischer Natur ist, d.h. sich gegen Vertreter sozial konstruierter Minderheitengruppen richten, wobei die Gewalttäter darauf zählen dürfen, mit ihren Taten auf Verständnis, Bestätigung oder Unterstützung in ihrer Bezugsgruppe zu stoßen.
Mittlerweile ist mit der Alternative für Deutschland (AfD) eine Partei des autoritären Nationalradikalismus entstanden, die eine Einstellung gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit an den Tag legt. Diese Partei ist sowohl im Deutschen Bundestag als auch in allen Landesparlamenten vertreten. Zu Recht wird sie in einen rechtsradikalen Kontext gerückt. Vor solchem Hintergrund müssen auch neuere rechtsterroristische Symptome gesehen werden, wie die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke und der antisemitische Anschlag auf die Synagoge in Halle.
Rechtsextreme Gewalt und Ausländerhass fanden bereits in den 1990er Jahren einen Höhepunkt in Brandanschlägen auf Migranten in Rostock, Hoyerswerda, Solingen und Mölln. Oftmals wurden die Verbrechen – die zu Recht als Pogrome bezeichnet werden – von Seiten der einheimischen Bevölkerung unterstützt. Von der Rechtsextremismusforschung wird eingeschätzt, dass tätliche Angriffe auf Minderheiten oder angebliche politische Gegner in Deutschland heute alltäglich seien. Diese Hasskriminalität, die sich aufgrund einer spezifischen Gruppenzugehörigkeit gegen Personen richte, sei Normalität und der eigentliche Skandal.
In solchen gesellschaftlichen Trends hatte der NSU-Prozess die besondere Bedeutung zu zeigen, dass die Justiz mit den Mitteln rechtsstrafrechtlichen Strafrechts und Strafprozessrechts konsequent gegen Rechtsterrorismus vorgeht und dabei auch die Interessen der Opfer berücksichtigt, die vor allem in der vollständigen Aufklärung des verbrecherischen Tatgeschehens des NSU und ihres Netzwerkes bestand.
Es wird jedoch darüber gestritten, ob und inwiefern das gelungen ist. Insbesondere die überlebenden Opfer und die Hinterbliebenen der Ermordeten fühlen sich in jenen Erwartungen enttäuscht, die gerade (die frühere) Bundeskanzlerin Angela Merkel erzeugte, indem sie vor Beginn des Prozesses eine volle Aufklärung der NSU-Verbrechen versprochen hatte. In Wirklichkeit ließ das Gerichtsverfahren viele Fragen offen, insbesondere im Hinblick auf die Rolle des Verfassungsschutzes sowohl bei der Gründung des NSU als auch bei der Planung und Ausführung der Verbrechen, ferner, ob es sich bei dem NSU tatsächlich allein um ein Trio handelte oder nicht vielmehr um ein viel weiter verzweigtes Netzwerk. In der Kritik steht zudem die ursprüngliche Ermittlungstätigkeit von Polizei und Staatsanwaltschaft. Sie legte ihren Fokus auf die Hypothese, die Taten müssten in einem Zusammenhang mit der türkischen Mafia stehen bzw. auf Revierkämpfe im Rauschgiftmilieu zurückgehen (Ramelsberger u.a., VII). Verdächtigt und gleichsam diskriminiert wurden damit auch die engsten Familienangehörigen der Opfer. Die eingesetzten Parlamentarischen Untersuchungsausschüsse, die sich teilweise parallel zu dem Gerichtsverfahren um Aufklärung bemühten, brachten etwas mehr Licht ins Dunkel, ohne erschöpfende Antworten zu finden (siehe näher unten 10.).
Gleichwohl klärte der Strafprozess gegen Beate Zschäpe und die anderen Angeklagten wichtige Tatsachen nicht zuletzt des Vorgeschehens der Verbrechen auf, die Ansatzpunkte für Schlussfolgerungen auf das gesellschaftliche Umfeld des NSU und damit zugleich für präventive Folgerungen erlauben.
Vor den Verbrechen hatte die Gruppe des NSU ihren Lebensmittelpunkt in Jena. Auch die Mitangeklagten lebten und stammen zum Teil aus Thüringen. Zschäpe, Mundlos, Böhnhardt und die Angeklagten Wohlleben und Gerlach gehörten Anfang bis Mitte der 1990er Jahre zu der sich entwickelnden Gruppierung „Kameradschaft Jena“, die politisch motivierte Aktionen durchführte. Alle ca. 20 Gruppenmitglieder identifizierten sich mit ausländerfeindlichen, antisemitischen und staatsfeindlichen politischen Inhalten. Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos waren jene Angehörigen der Gruppe, die Anfang des Jahres 1996 beschlossen, zukünftig ihrer Gesinnung auch mit Gewalt Ausdruck zu verleihen.
Zunächst handelte es sich dabei um reine Propagandaaktionen mit Bombenattrappen ohne Sprengstoff. Dazu gehörten mit unterschiedlicher Beteiligung von Zschäpe, Böhnhardt, Mundlos und Wohlleben Herstellung und öffentliches Aufhängen einer Puppe mit sogenanntem „Judenstern“, Verschickung von Bombenattrappen mit anonymen Drohbriefen, auf denen sich Hakenkreuze und Sigrunen befanden, an Polizei und andere öffentliche Einrichtungen, um dort Angst und Schrecken zu verbreiten. In sukzessiver Radikalisierung versuchten sie, sich funktionsfähige Bomben zu verschaffen, und, als das misslang, Bomben und Zündvorrichtungen selbst herzustellen. Auch diese Bemühungen blieben erfolglos. Im Januar 1998 wurde die vom NSU als Bombenwerkstatt genutzte Garage von den Ermittlungsbehörden durchsucht. Daraufhin entzog sich das Trio den weiteren Ermittlungen durch Flucht und Abtauchen in den Untergrund, wozu Wohlleben Hilfe leistete. Wohlleben, Gerlach und Schultze standen mit Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos während deren Alltagsleben im Untergrund in Kontakt und unterstützen sie auf verschiedene Weise. Die drei Geflüchteten wohnten in verschiedenen Unterkünften und kamen auch mit Eminger in Kontakt.
Im weiteren Verlauf ihres Lebens im Untergrund beschlossen Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt, aus ihrer nationalsozialistisch-rassistischen Grundhaltung heraus, Tötungsdelikte zu begehen. Als Opfer sollten Menschen mit südländischen – insbesondere türkischen – Wurzeln ausgewählt werden, ferner Vertreter staatlicher Institutionen wie beispielsweise Polizeibeamte. Es sollte sich um beliebige zufällige Opfer handeln. Zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes verständigten Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt sich zudem auf die Begehung von Raubüberfällen. Die eigentliche Tatausführung sollte arbeitsteilig erfolgen. Mundlos und Böhnhardt wollten die Taten unmittelbar durchführen. Zschäpe sollte sie absichern, indem sie „die Stellung“ in der gemeinsamen Wohnung als Ausgangs- und Rückzugspunkt für Böhnhardt und Mundlos (räumlicher Fixpunkt) hielt, zugleich aber die Abwesenheitszeiten der Tatausführenden gegenüber dem Umfeld legendierte, um eine sichere Rückzugsmöglichkeit zu schaffen und zu erhalten. Sie vereinbarten ferner, zum Zwecke einer späteren Veröffentlichung ein glaubhaftes Dokument zu erstellen, „indem sie – unter Wahrung ihrer Anonymität als Mitglieder – die Existenz ihrer erfolgreich agierenden rechtsextremistischen Vereinigung darstellten, die sich aller begangenen Anschlagstaten bezichtigte“ (Urteil, S. 73). Für den Fall drohender Festnahme beschlossen Böhnhardt und Mundlos, sich zu töten. Das Trio kam überein, dass in diesem Fall Zschäpe das Bekennerdokument in Umlauf bringen und Beweismittel zerstören sollte.
Ab Mitte Dezember 1998 begannen sie ihren Plan zunächst durch Raubüberfälle umzusetzen. Danach erfolgten die zehn Morde sowie weitere Anschläge, bei denen Opfer schwer verletzt wurden. Zwischenzeitlich fanden erneut Raubüberfälle statt. Ein Teil der Verbrechen wurde in mehreren von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe gefertigten Bekennervideos dokumentiert.
Nach einem Überfall durch Böhnhardt und Mundlos auf eine Sparkasse in Eisenach am 4. November 2011 mussten beide damit rechnen, von der Polizei gefasst und enttarnt zu werden. Zwei Polizisten hatten das Wohnmobil, das ihnen als Fahrzeug zu den jeweiligen Orten der Verbrechen diente, entdeckt, was sie bei ihrer Rückkehr nach dem Raubüberfall auf die Sparkasse bemerkten. Der Versuch, sich durch Schusswaffenanwendung der Verhaftung zu entziehen, schlug fehl. Daraufhin setzten sie das Wohnmobil in Brand, um alle dort vorhandenen Beweismittel zu vernichten, und erschossen sich.
Zschäpe, die in der Wohnung zurückgeblieben war, erfuhr davon durch den Rundfunk. Wie für diesen Fall vereinbart, setzte sie die gemeinsam als Ausgangs- und Fluchtpunkt für die Verbrechen genutzte Wohnung in Brand, um Beweismittel zu vernichten. Sie begab sich auf die Flucht und schickte die Bekennervideos an politische, religiöse und kulturelle Einrichtungen sowie an Presseunternehmen, um die von der Organisation „NSU“ begangenen Morde und Sprengstoffanschläge mit der besprochenen Zielsetzung ohne Offenlegung ihrer eigenen Identität der Öffentlichkeit bekanntzumachen.
Zschäpe reiste in den nächsten Tagen mit dem Zug in mehrere Städte Deutschlands und stellte sich am 8. November 2011 in Begleitung ihres Verteidigers der Polizei.
4. Die Anklage
Die Bundesanwaltschaft erhob am 8. November 2012 vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts München Anklage gegen Beate Zschäpe als mutmaßliches Mitglied der terroristischen Vereinigung „Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)“ sowie gegen die vier mutmaßlichen Unterstützer und Gehilfen des „NSU“, Ralf Wohlleben, Carsten Schultz, Andre Eminger sowie Holger Gerlach.
Beate Zschäpe wurde vorgeworfen, sich als Gründungsmitglied des „NSU“ mittäterschaftlich an der Ermordung von acht Mitbürgern türkischer und einem Mitbürger griechischer Herkunft, dem Mord bzw. Mordversuch an zwei Polizeibeamten in Heilbronn sowie an den versuchten Morden durch Sprengstoffanschläge des „NSU“ in der Kölner Altstadt und in Köln-Mühlheim beteiligt zu haben. Darüber hinaus sollte sie als Mittäterin für 15 bewaffnete Raubüberfälle verantwortlich sein. Ferner wurde ihr zur Last gelegt, die Unterkunft in Zwickau in Brand gesetzt und sich dadurch wegen versuchten Mordes an einer Nachbarin und zwei Handwerkern sowie wegen besonders schwerer Brandstiftung strafbar gemacht zu haben.
Ralf Wohlleben und Carsten Schultze wurden wegen Beihilfe zum Mord an den acht Mitbürgern mit Migrationshintergrund durch die Beschaffung der Tatwaffe Ceska 83 nebst Schalldämpfer angeklagt. Gegenüber André Eminger lautete die Anklage auf Beihilfe zum versuchten Mord in Tateinheit mit Beihilfe zu einem Sprengstoffanschlag des NSU sowie auf Beihilfe zum Raub und Unterstützung der terroristischen Vereinigung NSU. Holger Gerlach wurde die Unterstützung der terroristischen Vereinigung NSU in drei Fällen vorgeworfen.
5. Die Verteidigung
5.1. Verteidigungsstrategien
Die Verteidigung war sehr heterogen und in jeder Hinsicht konfliktreich. Im Wesentlichen lassen sich dazu zwei Ausrichtungen erkennen (die sich auch in den Plädoyers spiegeln, siehe unten 6. c). Die folgenden Ausführungen legen den Fokus auf die Verteidigung von Beate Zschäpe und von Ralph Wohlleben, die sowohl die aktivste Verteidigerrolle in der Hauptverhandlung einnahmen als auch sich in ihrem Vorgehen stark voneinander abhoben. Vorweg ist zu bemerken, dass ein Teil der für die Verteidigungsstrategie bezeichnenden Anträge unmittelbar nach Eröffnung der Hauptverhandlung und noch vor Verlesung der Anklage am ersten Verhandlungstag gestellt wurde (siehe unten 5.1.a und 5.1.b), was prozessrechtlich auch erforderlich war. Im Grunde aber wurden sämtliche Anträge der Verteidigung, die für ihre Verteidigungsstrategie kennzeichnend waren, durch den 6. Senat des OLG München abgelehnt.
Es ließe sich diskutieren, ob es zwischen den Verteidigungsstrategien im NSU-Prozess und der Verteidigung in den RAF-Verfahren gewisse Parallelen gibt. Solche sind jedenfalls nicht zu übersehen (zur Verteidigung in den RAF-Verfahren siehe u.a. Diewald-Kerkmann/Holtey, S. 17–135; Honecker/Kaleck, S. 557–588; Groenewold, in: Drecktrah [Hrsg.], S. 105–138; Mehlich; Müller, in: Drecktrah [Hrsg.], S. 95–103; Jeßberger/Schuchmann, Prozess), insbesondere weil etliche Verteidigungsaktivitäten in beiden großen historischen Prozessen sich gegen gerichtliche Beschränkungen der Verteidigungsausübung richteten. Zwar erfolgten derartige Beschränkungen im RAF-Prozess in weit größerem Maße als im NSU-Prozess; sie setzten sich zudem in einer besonders restriktiven Gesetzgebung im Gefolge der Ausübung der Verteidigungsrechten im RAF-Prozess fort. In etwas kleinerem Rahmen kann man dies im NSU-Verfahren jedoch ebenfalls erkennen. So zeugen die drei Reformgesetze zur StPO aus den Jahren 2017 bis 2021 von einer weiteren Beschneidung von Beschuldigten- und Verteidigerrechten, die sich zumindest auch auf die Erfahrungen im NSU-Prozess zurückführen lässt (und sich hier sogar auf die Nebenklagerechte erstreckte, siehe unten 10. a). Generell lässt sich festzustellen, dass das Bestreben des Gerichts wie im RAF-Prozess auch im NSU-Prozess darauf bedacht war, das Verfahren nicht als ein politisches erscheinen zu lassen, sondern als „normalen“ Strafprozess, wenn auch nicht als einen gewöhnlichen (siehe dazu unten 9.). Dies mag die restriktive Haltung des Gerichts gegenüber den Verteidigungsaktivitäten jedenfalls mit zu erklären.
a) Verletzung des Grundsatzes des fairen Verfahrens
aa) Öffentliche Vorverurteilung
Angeprangert wurde von der Verteidigung Zschäpes wie auch von der Verteidigung Wohllebens, dass diese Angeklagten bereits vorverurteilt gewesen seien, bevor die Verhandlung überhaupt begann. Öffentliches vorverurteilendes Vokabular sei unmittelbar in die Arbeit der Ermittler eingeflossen. Die Worte „Terrortrio“ und „Mörderbande“ (ohne „mutmaßlich“ hinzuzufügen), seien auch von Politikern vor dem Prozess öffentlich geäußert wurden. Zschäpe sei von Beginn des Verfahrens an zum Objekt degradiert worden. Sie hätte als Mitglied einer „Mörderbande“ von vornherein festgestanden; davon seien die gesamten Ermittlungen ausgegangen, die nur noch nach Beweisen für diese Annahme gesucht hätten.
Hieraus ergebe sich die Notwendigkeit, das Verfahren einzustellen, da die öffentliche Vorverurteilung ein nicht mehr behebbares Verfahrenshindernis darstelle. Von der Verteidigung wurde dabei nicht thematisiert, dass Vorverurteilungen in Wirklichkeit bereits damit begonnen hatten, als die Ermittlungen sich zunächst auf die familiären Strukturen, also auf das türkische Umfeld der Opfer gerichtet hatten und ein rassistischer, fremdenfeindlicher und neonazistischer Hintergrund der Taten dabei nicht in den Blick geraten war. Dazu kam es erst weitaus später.
bb) Verweigerte Akteneinsicht und Vorenthaltung von Akten
Die Verteidigung beantragte, Akten von parlamentarischen Untersuchungsausschüssen in den Prozess ebenso einzubeziehen wie alle Akten der Landesstaatsanwaltschaften, die der Generalbundesanwalt in seine Ermittlungen einbezogen hatte. In diesem Zusammenhang verlangte die Verteidigung Zschäpes ferner, Bundesanwalt Diemer und Oberstaatsanwältin Greger als Sitzungsvertreter abzulösen und sie durch andere Staatsanwälte zu ersetzen, weil sie Akten nicht in erforderlicher Weise weitergeleitet, nicht objektiv und fair agiert und sich voreingenommen über Zschäpe geäußert hätten.
Verfahrensakten zu verschiedenen V‑Leuten seien der Verteidigung vorenthalten wurden. Es seien sogar relevante Akten vernichtet worden. Die Verfassungsschutzbehörden hätten die noch vorhandenen Akten nur widerwillig und unvollständig herausgegeben. Dadurch sei der Strafanspruch des Staates verwirkt.
In diesem Zusammenhang bezog sich die Verteidigung ferner auf die Verwicklung des Geheimdienstes in die angeklagten Taten des NSU, was ein nicht behebbares Verfahrenshindernis darstelle, weshalb auch aus diesem Grund das Verfahren einzustellen sei. Wegen der Vorenthaltung bzw. des Fehlens der Akten sei eine ordnungsgemäße Beweisaufnahme nicht mehr gewährleistet.
cc) Kritik an der Prozessleitung des Vorsitzenden Götzl
Angegriffen wurde zunächst die „Sitzungspolizeiliche Anordnung des Vorsitzenden zur störungsfreien Abwicklung der Hauptverhandlung“, insoweit sie die Verteidigung betraf. Die Verteidigung kritisierte die darin angeordnete Untersuchung der Verteidiger beim Einlass, also die gerichtliche Zugangskontrolle; sie stellte die Frage, warum nur die Verteidiger untersucht würden, nicht aber die Staatsanwälte, Richter und Polizisten. Die Verteidiger sahen hierin einen Eingriff in ihre verfassungsrechtlich geschützten Rechtspositionen und eine Diskriminierung. Zugleich trugen sie vor, dadurch werde Misstrauen bei den Angeklagten gesät, ob die Verteidigung überhaupt sachgerecht erfolgen könne. Gegen den Vorsitzenden wurde deswegen ein Befangenheitsantrag gestellt, der jedoch zurückgewiesen wurde.
Kritisiert wurde die Prozessleitung des Vorsitzenden ferner deshalb, weil dieser die Nebenklage stets vor der Verteidigung zu Wort kommen ließ. Der Antrag, dem abzuhelfen, blieb ebenfalls erfolglos.
b) Verletzung des Grundsatzes der Öffentlichkeit
Von der Verteidigung wurde gefordert, das Akkreditierungsverfahren für Journalisten zu wiederholen, da es Anhaltspunkte gebe, dass auch das zweite Verfahren mangelhaft durchgeführt worden sei. Beklagt wurde in diesem Zusammenhang die fehlende Einsicht der Verteidigung in die dazu vorhandenen Unterlagen.
Die Verteidigung kritisierte zudem, der Sitzungssaal sei zu klein, denn die Sicht von der Zuschauertribüne sei begrenzt, das auf die Wand projizierte Bild der Nebenkläger sei nur undeutlich erkennbar, dagegen seien die Computer und die Unterlagen der Verteidiger von Zschäpe von der Richterbank aus voll einsehbar. Beantragt wurde deshalb die Hauptverhandlung in einen größeren Saal zu verlegen und zu diesem Zweck die Hauptverhandlung auszusetzen. Zschäpes Verteidigung forderte zudem, die gesamte Verhandlung aufzeichnen zu lassen, ein Antrag, der nach Verlesung der Anklage gestellt wurde (siehe oben 5.1.a).
c) Materiellrechtliche Verteidigung
Im Hinblick auf die Vorwürfe der Anklage waren Zschäpes Verteidiger darauf bedacht, eine Mittäterschaft an den Morden sowie die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung in Abrede zu stellen. Darauf zielte ihr Agieren während der gesamten Beweisaufnahme. Diese Feststellung bezieht sich sowohl auf die sogenannten „Altverteidger“ Zschäpes als auch auf die „Neuverteidiger“ (siehe unten 5.2.). Letztere veränderten allerdings das Aussageverhalten Zschäpes, indem sie ihr zu Einlassungen rieten. Damit sollte versucht werden, sie nicht als aktives Mitglied des NSU erscheinen zu lassen, sondern als jemand, der die Taten von Böhnhard und Mundlos nicht wollte, aber nicht von beiden Männern loslassen konnte (siehe unten 6.c).
d) Ideologische Verteidigung sowie Verteidigung des Rechtsstaats
Im weiteren Prozessgeschehen wurde ein gravierender Unterschied zwischen der Verteidigung von Zschäpe auf der einen Seite und der Verteidigung von Wohlleben auf der anderen Seite deutlich. Die Verteidigung Wohllebens nutzte zwar konsequent die rechtsstaatlichen Mittel und Möglichkeiten, jedoch war zu erkennen, dass sie sich zugleich in einer ideologischen Nähe zu der neonazistischen Gesinnung Wohllebens befand. Darauf von anderen Verteidigern wie auch von Nebenklägern im Prozess angesprochen, bestritt die Verteidigung Wohllebens das, aber es war kein Geheimnis, dass Olaf Klemke, der als ein hervorragender Jurist gilt, Wolfgang Nahrath sowie Nicole Schneiders sich als sogenannte „Szene-Anwälte“ verstanden, und daraus machten sie auch während des Verfahrens keinen Hehl. Insofern kann hier von einer Verteidigungsstrategie der „ideologischen Verteidigung“ gesprochen werden, die der Rechtsstaat freilich hinzunehmen und zu dulden hat. Er billigt seine Mittel und Möglichkeiten ausdrücklich auch jener Verteidigung zu, die nur formal davon Gebrauch machen bzw. dies mit der Verteidigung der rechten Ideologie verbinden will, solange sich daraus kein Verdacht von Straftaten der Verteidiger ergibt. Das aber war bei der Verteidigung Wohllebens nicht der Fall (siehe auch unten 5.2.).
Demgegenüber benutzte die Verteidigung Zschäpes – wie auch der größte Teil der Verteidigung der übrigen Angeklagten – die rechtsstaatlichen Mittel bei der Verteidigung nicht nur, sondern sie verteidigte zugleich den Rechtsstaat, indem sie dabei, anders als die Verteidigung Wohllebens, erkennbar von demokratischen und humanistischen Werten ausging, sich also bei der Verteidigung niemals menschenrechts- und demokratiefeindlich äußerte (siehe Arnold, StV 2023, 184, 189). Insoweit ist es durchaus angebracht, davon zu sprechen, dass eine solche Verteidigung zugleich den bürgerlich-demokratischen und liberalen Rechtsstaat verteidigt.
5.2. Besondere Probleme der Verteidigung Zschäpes – die sog. „Verteidigerkrise“
Spezielle Verteidigerprobleme sind insbesondere im Hinblick auf Ereignisse rund um die Verteidigung der Angeklagten Zschäpe zu beobachten. Ihre Verteidigung erfolgte zunächst in Form der Pflichtverteidigung durch zwei Verteidiger und eine Verteidigerin (Wolfgang Stahl, Wolfgang Heer, Anja Sturm). Ihre Strategie hinsichtlich des Aussageverhaltens von Zschäpe bestand darin, keine Einlassung zur Sache abzugeben. Im Verlaufe des Verfahrens verschlechterte sich jedoch das Verhältnis zwischen Zschäpe und ihren Verteidigern. Zschäpe erklärte ihnen gegenüber ihr Misstrauen. Das erste Mal erfolgte das am 16. Juli 2014, dem 129. Verhandlungstag. Die Angeklagte beantragte, die Beiordnung ihrer Verteidiger zu widerrufen, was vom Gericht abgelehnt wurde, weil der Antrag keine konkreten und hinreichenden Anhaltspunkte für eine endgültige oder nachhaltige Störung des Vertrauensverhältnisses enthalte.
Danach beantragte Zschäpe mehrfach, einzelne ihrer drei Verteidiger zu entpflichten, zunächst am 209. Verhandlungstag Rechtsanwältin Sturm. Diesen Anträgen gab das Gericht ebenso wenig statt wie den daraufhin gestellten Anträgen der Verteidigung, sie ihrerseits zu entpflichten. In diesen Anträgen brachten die Pflichtverteidiger vor, sich nicht als Sicherungsverteidiger zu sehen, die nur dafür zu sorgen hätten, dass der Prozess „nicht platzt“ (Friedrichsen, 222).
Das Gericht ordnete Zschäpe jedoch einen weiteren, von ihr gewählten Pflichtverteidiger bei (Matthias Grasel), der damit allerdings nach zwei Jahren Prozessdauer einstieg und zunächst über keine bzw. nur geringe Akten- und Prozesskenntnis verfügte. Zusätzlich übernahm mit Rechtsanwalt Hermann Borchert ein Wahlverteidiger die Vertretung Zschäpes, der mit Grasel in einer Anwaltskanzlei tätig ist. Borchert agierte zunächst als Helfer im Hintergrund für Grasel. Grasel und Borchert genossen nun das alleinige Vertrauen Zschäpes. Die drei sogenannten „Altverteidiger“ hatten damit kaum noch eigenständige Verteidigungsmöglichkeiten.
Dazu kam, dass Zschäpe die „Altverteidiger“ wegen Verletzung der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht bei der Staatsanwaltschaft München anzeigte. Sie warf ihnen vor, ohne ihr Wissen Gespräche mit dem Vorsitzenden geführt zu haben. Das schloss Zschäpe offenbar aus einem in der Hauptverhandlung durch Götzl verlesenen Aktenvermerk, aus dem hervorging, die Verteidiger hätten den Vorsitzenden wissen lassen, dass die Angeklagte zu jeder Zeit hätte aussagen können, wenn sie es gewollt hätte (Friedrichsen, Zschäpe und ihr neuer Einflüsterer; https://www.deutschlandfunk.de/nsu-prozess-zschaepe-zeigt-drei-ihrer-anwaelte-an-100.html – zuletzt aufgerufen: 21.8.2023). Die Staatsanwaltschaft München I lehnte jedoch die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens ab; das Verhalten der Rechtsanwälte erfülle keinen Straftatbestand. Vielmehr handele es sich bei den Angaben der Pflichtverteidiger gegenüber dem Gericht um ein legitimes Verhalten von Anwälten. Diese agierten „als Organe der Rechtspflege selbständig und unabhängig von der Angeklagten“, so die Staatsanwaltschaft. Demnach seien durch die Verteidiger keinerlei Informationen an das Gericht weitergegeben worden, die sich auf die Frage der Schuld oder Unschuld der Angeklagten bezögen (Assmann, Zschäpe scheitert mit Anzeige). Diese Begründung der Staatsanwaltschaft ist jedoch nicht unproblematisch. Sie unterstellt, dass sich jeder Anwalt, jeder Strafverteidiger als „Organ der Rechtspflege“ versteht. Dies ist zwar das herrschende Verständnis von Lehre und Rechtspraxis, berücksichtigt aber nicht durchaus legitime andere Auffassungen, wie die Vertrags- oder die Autonomietheorie, die besagen, der Verteidiger handele einzig im Interesse des Mandanten (vgl. Arnold, Entwicklungen der Strafverteidigung, S. 119 ff.). Wäre ein solches Verständnis zugrunde gelegt worden, dann hätte die Staatsanwaltschaft möglicherweise doch zur Feststellung der Verletzung der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht gelangen können.
Im weiteren Prozess fand keine Zusammenarbeit zwischen den „Alt-“ und „Neuverteidigern“ statt. Die „Altverteidiger“ nutzten für die weitere Verteidigung lediglich zum Ende der Hauptverhandlung die Plädoyers. Diese trugen sie so engagiert vor, als hätten sie Zschäpe den gesamten Prozess über aktiv verteidigt. Man kann dieses Verhalten allerdings auch als Selbstverteidigung der Verteidiger einordnen (Sundermann, Selbstverteidigung der Verteidiger).
Es wird davon ausgegangen, dass der Kontakt von Zschäpe zu ihren neuen Verteidigern hinter dem Rücken der Altverteidiger in der U‑Haft zustande kam, u.a. deswegen, weil Zschäpe mit der Verteidigungsstrategie des Schweigens nicht mehr einverstanden gewesen sein soll, wie der Münchener Psychiater Nedopil im Rahmen seiner Untersuchung Zschäpes feststellte (Friedrichsen, S. 216 ff.; siehe auch Frees, S. 212 ff.). Die neuen Verteidiger überzeugten ihre Mandantin davon, eine Erklärung abzugeben. Das kündigten sie auch an, weshalb die Erwartungen daran sehr hoch waren. Nach Einschätzung von Prozessbeobachtern versuchte Zschäpe mit ihrer Erklärung, sich als emotionale Gefangene darzustellen, als eine Frau, die es einfach nicht schaffte, ihre Männer zu verraten und eigene Wege zu gehen. Böhnhardt soll sie zudem geschlagen haben (Schultz, S. 400). Man schenkte ihr jedoch keinen Glauben.
Ein weiterer Schwerpunkt der Konfrontation zwischen Verteidigung und Gericht war die Frage der forensischen Begutachtung Zschäpes. Der vom Gericht bestellte psychiatrische Sachverständige Saß konnte seine Einschätzungen nur durch Beobachtungen der Angeklagten im Prozess gewinnen, da Zschäpe jegliches Gespräch mit ihm verweigerte. Aufgrund seines Gutachtens beantragte die Verteidigung, den Sachverständigen zu entpflichten und ein methodenkritisches Gutachten einzuholen; seine Arbeit genüge nicht den wissenschaftlichen Standards. Zwar wurde durch einen weiteren Sachverständigen ein solches Gutachten abgegeben und ein von der Verteidigung beauftragter Gutachter, mit dem die Angeklagte auch sprach, erstattete ebenfalls ein Gutachten, doch drang der methodenkritische Gutachter nicht durch. Der Gutachter, mit dem Zschäpe sprach, wurde von einer Vertreterin der Nebenklage wegen Besorgnis der Befangenheit erfolgreich abgelehnt.
5.3 Konflikte zwischen Verteidigung und Nebenklägern
Ein weiterer Konflikt bestand in der fast dauerhaften Konfrontation zwischen der Verteidigung und den Vertretern der Nebenklage. Die Verteidigung sah sich dabei insbesondere dem Vorwurf ausgesetzt, die Opferrechte nicht zu beachten. Von Seiten einiger Verteidiger wurden umgekehrt verschiedene Nebenkläger beschuldigt, den Prozess für politische Zwecke zu missbrauchen, indem sie ständig kritisierten, dass Gericht und Bundesanwaltschaft den Aufklärungsfokus nicht auf die gesellschaftlichen und politischen Zusammenhänge im Hinblick auf Rassismus sowie auf die Verstrickungen des Staates in das Tatgeschehen legten, letzteres vor allem im Hinblick auf die Aktivitäten des Verfassungsschutzes. Seinen markantesten Ausdruck fand dieser Streit in den Plädoyers von Verteidigern und Nebenklägern in Bezug darauf, was zu sagen in den Schlussvorträgen zulässig sei und was nicht.
Konfrontativ ging es auch zwischen einigen Nebenklagevertretern und denjenigen Anwälten zu, die der rechten Szene zugeordnet werden. So zählten zu Wohllebens Anwälten mit Nicole Schneiders eine Ex-NPD-Funktionärin sowie mit Rechtsanwalt Wolfgang Nahrath der Ex-Chef der inzwischen verbotenen “Wiking Jugend”, zugleich einstiger Sänger einer Rechtsrock-Band und nach wie vor NPD-Mitglied. Immer wieder haben sie und der Wohlleben ebenfalls verteidigende Rechtsanwalt Olaf Klemke den NSU-Prozess als Plattform für Neonazipropaganda genutzt. U.a. wollten sie qua Beweisantrag den drohenden Volkstod beweisen sowie eine Ermordung des Hitler-Stellvertreters Rudolf Hess in der Haft. Das Plädoyer von Rechtsanwalt Nahrath wird als Versuch eines Plädoyers für den Nationalsozialismus gewertet (Ramelsberger/Ramm; Baur).
Im Vorfeld des NSU-Prozesses wurde in der Anwaltschaft, insbesondere in den Strafverteidigervereinigungen, die Frage diskutiert, ob man Nazis überhaupt verteidigen dürfe (Arnold, StV 2022, 115 ff.). Anlass war dabei auch, dass Anja Sturm ihre Berliner Anwaltskanzlei verließ, weil – wie verschiedentlich berichtet wurde – dort Kritik an ihrer Übernahme der Verteidigung der Hauptangeklagten im NSU-Prozess geübt worden war. Die Berliner Strafverteidigerorganisation stellte sich jedoch hinter Sturm (Speit; Jansen).
6. Die Plädoyers
a) Bundesanwaltschaft
Von der Bundesanwaltschaft plädierte als erster Bundesanwalt Diemer. Er legte besonderen Wert darauf, dass es – wie oftmals kolportiert werde – falsch sei, der NSU-Prozess hätte seine Aufgabe nur teilweise erfüllt, weil er mögliche Fehler staatlicher Behörden nicht aufgeklärt habe (Ramelsberger, Bd. IV, S. 1510). Alle anderen Spekulationen selbsternannter Experten, die so täten, als habe es die Beweisaufnahme nicht gegeben, seien wie Irrlichter, wie Fliegengesumme in den Ohren (https://www.nsu-watch.info/2017/07/protokoll-375-verhandlungstag-25-juli-2017/ zuletzt aufgerufen: 21.10.2023). Diemer betonte, es sei Aufgabe der politischen Gremien, mögliche Fehler staatlicher Behörden aufzuklären. Ein strafprozessualer Aufklärungsansatz komme erst dann in Betracht, wenn Anhaltspunkte für ein strafbares Verhalten von Personen vorlägen. Wären Anhaltspunkte für eine strafrechtliche Verstrickung von Angehörigen staatlicher Stellen im Ermittlungsverfahren aufgetreten, so wären sie auch in gesetzlich vorgesehener Weise aufgeklärt worden. Die Aufklärung eines weiteren Unterstützerumfeldes, also die Entdeckung möglicher weiterer strafbarer Unterstützer des NSU, sei bei entsprechenden Anhaltspunkten Aufgabe weiterer Ermittlungen. Sie habe nicht Aufgabe dieses Strafprozesses sein können, denn dessen Gegenstand sei von Rechts wegen durch die zur Anklage gebrachten Personen und Taten vorgegeben. Diese klaren Strukturen müssten in einem Rechtsstaat eingehalten werden. Der Senat und der Generalbundesanwalt hätten dies getan. Anderes zu behaupten, verunsichere die Opfer und die Bevölkerung (Ramelsberger, Bd. IV, S. 1510).
Bezogen auf den strafprozessualen Gegenstand der Hauptverhandlung, nämlich die angeklagten Taten und den Umfang der Schuld der Angeklagten, sei die Beweisaufnahme ihrer systemrelevanten Bedeutung für die Rechtspflege, aber auch der menschlichen, gesellschaftlichen und historischen Bedeutung dieses Strafprozesses in jeder Hinsicht gerecht geworden. Sie sei in ihrem Ausmaß, ihrer Gründlichkeit und ihrer Gewissenhaftigkeit das adäquate Pendant zu dem ungeheuer komplizierten Verfahrensstoff mit den heftigsten und infamsten Terroranschlägen in der Bundesrepublik Deutschland seit den linksextremistischen Mordanschlägen der RAF. Die umfassende Beweisaufnahme habe die Anklage des GBA hinsichtlich aller fünf Angeklagten in objektiver und subjektiver Hinsicht in allen wesentlichen Punkten bestätigt (Ramelsberger, Bd. IV, S. 1510).
Oberstaatsanwältin Greger übernahm es sodann, zur Würdigung der Beweise im Zusammenhang mit der Angeklagten Zschäpe und der terroristischen Vereinigung NSU vorzutragen. Ihr Fokus lag auf Ausführungen, dass Zschäpe – obwohl nicht eigenhändig an der Ausführung der Taten durch Böhnhardt und Mundlos beteiligt – dennoch gleichberechtigtes Mitglied im NSU gewesen und in die Organisation und Logistik arbeitsteilig eingebunden gewesen sei. Zschäpe habe das System NSU getarnt und auf diese Weise an der Ausführung der Taten mitgewirkt. Ihre Rolle stelle sich in der rechtlichen Bewertung als ebenso essenziell für jede einzelne Tat dar wie die der beiden männlichen Gruppenmitglieder. Weder die Anschläge noch die Überfälle hätten ohne ihr Zutun in dieser Form stattfinden und gelingen können. Die Angeklagte sei der entscheidende Stabilitätsfaktor der Gruppe gewesen. Ihre Rolle im Hintergrund entspreche nicht nur dem ideologischen Geschlechterbild in der rechten Szene. Bereits in den Jahren 1996 bis 1998 habe sich die Angeklagte bei den gemeinsam verübten Straftaten in Jena von den Tatorten ferngehalten und diese abgesichert. Nach der Auflösung des NSU habe Zschäpe alles darangesetzt, Beweismittel zu vernichten (Ramelsberger, Bd. IV, S. 1513–1516).
Oberstaatsanwalt Weingarten befasste sich mit der Beweiswürdigung hinsichtlich der anderen Angeklagten. Auch hinsichtlich dieser hätte sich die Anklage im Wesentlichen in vollem Umfang bestätigt. Abschließend äußerte sich Bundesanwalt Diemer zu den Rechtsfolgen und beantragte
- für die Angeklagte Zschäpe eine lebenslange Freiheitsstrafe mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und anschließender Sicherungsverwahrung,
- für den Angeklagten Wohlleben eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren,
- für den Angeklagten Schultze eine Jugendstrafe von drei Jahren, unter Berücksichtigung seiner im Prozess gezeigten Aufklärungshilfe und seines Schuldeingeständnisses,
- für den Angeklagten Gerlach eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und
- für den Angeklagten Eminger eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren. Zugleich wurde beantragt, gegen Eminger Haftbefehl zu erlassen und ihn in Untersuchungshaft zu bringen, weil Fluchtgefahr bestehe. Das Gericht folgt dem Haftantrag und ließ Eminger inhaftieren.
b) Nebenkläger
Ein großer Teil der Nebenkläger in diesem Prozess verstand sich dezidiert als politisch. In ihren Plädoyers kritisierten sie vor allem, der Prozess habe die öffentlich geweckten politischen Erwartungen nach umfassender Aufklärung nicht erfüllt. Bezogen wurde das auf die unterbliebene Aufdeckung der Helfershelfer und Hintermänner sowie auf die enttäuschten Erwartungen der Nebenkläger und der Opferfamilien zu erfahren, „warum und auf welche Weise ihre Väter, Ehemänner, Geschwister ins Visier des NSU-Netzwerkes gerieten und schließlich ermordet wurden“ (Kaleck, in: von der Behrens [Hrsg.], S. 8). Dies widerspreche nicht den Aufgaben des Strafprozesses, „die Tat im strafprozessualen Sinne und alle daran Beteiligten mit den strafprozessual möglichen Mitteln zu beleuchten und dann über die Schuld der auf der Anklagebank Sitzenden zu urteilen und gegebenenfalls weitere Ermittlungen anzustellen“ (Kaleck, S. 8). Die politischen Nebenkläger verwahrten sich in diesem Zusammenhang in ihren Plädoyers mit Entschiedenheit gegen die Bemerkung von Bundesanwalt Diemer, die Kritik, der NSU-Prozess sei weitgehend hinter den Erwartungen an die Aufklärung des Tatgeschehens zurückgeblieben, sei wie Irrlichter, wie Fliegengesumme in den Ohren. Stattdessen hätte der Prozess verdeutlicht, wie unhaltbar die „Trio-These“ der Bundesanwaltschaft von nur drei Haupttätern sei. Unter Bezug auf die Rechtsprechung des EGMR wurde vorgetragen, es sei für den Senat Rechtspflicht gewesen, auch die Tatumstände – wie die Unterstützung bei der Auswahl des Tatorts oder bei der Durchführung der Tat – sowie die Kenntnisse staatlicher Behörden von Tätern und Tat aufzuklären und zu berücksichtigen (von der Behrens, in: von der Behrens [Hrsg.], S. 199; siehe dazu auch Schüler). Fatal sei nicht zuletzt die unterbliebene Aufklärung der Rolle der Inlandsgeheimdienste in dem gesamten NSU-Komplex. Die diversen Aktenvernichtungsaktionen und die auf verschiedenen Ebenen erfolgte Verdunkelung von Staats wegen wirkten wie eine Fiktion. Auf alle erdenkliche Weise würden durch staatliche Stellen, auch durch die Bundesanwaltschaft, Informationen und Aktenmaterial zurückgehalten. Das erinnere an die Vertuschung der Hintergründe des Oktoberfest-Attentates 1980 in München. Die Nebenklage forderte, der Prozess dürfe keinen Schlussstrich darstellen (Kaleck, S. 9 f.). Sie erhob in ihren Plädoyers auch die Forderung, den strukturellen Rassismus insbesondere bei den Strafverfolgungsbehörden aufzuarbeiten und anhand von Fakten diese Kritik zu belegen. Dabei gehe es darum, möglichst genau darzulegen, wo systemische Versäumnisse der Ermittlungsbehörden und Geheimdienste lagen und wo Anhaltspunkte für zukünftige Recherchen liegen könnten, „was also konkret für die Betroffenen der NSU-Straftaten von Bedeutung sei“ (Kaleck, S. 11).
Andere Nebenkläger grenzten sich in ihren Plädoyers von denen der politischen Nebenkläger dezidiert ab. Sie wiesen die Vorwürfe des strukturellen Rassismus ebenso zurück sowie die Kritik, dass im Prozess nicht auch weitere Täter und weitere Umstände, wie auch die Verstrickung des Verfassungsschutzes, aufgeklärt worden seien.
Während einer Reihe von Plädoyers von politischen Nebenklagevertretern machte die Verteidigung gegenüber dem Gericht geltend, diese Nebenklagevertreter sprächen nicht zur Sache, nicht zu den konkreten Taten; politische Statements seien zu unterlassen. Der Vorsitzende wurde aufgefordert, solche Ausführungen zu unterbinden. Daraufhin entwickelten sich teilweise heftige Dispute zwischen Nebenklagevertretern und Verteidigern, als deren Ergebnis der Vorsitzende Götzl derartige Ausführungen der Nebenkläger meistens zuließ. Das wiederum führte dazu, dass die Verteidigung die Sitzungsleitung des Vorsitzenden beanstandete, was durch den Senat mit Beschluss als unzulässig zurückgewiesen wurde.
c) Verteidiger
Als erster Verteidiger plädierte Rechtsanwalt Borchert. Er sah die Mittäterschaft von Zschäpe nicht als erfüllt an und argumentierte dabei besonders gegen die von der Bundesanwaltschaft angenommene Aufgabenverteilung zwischen Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt. Ebensowenig vermochte Borchert eine rechtsextremistische Motivation der Angeklagten in ihren Taten zu sehen. Borchert würdigte das Prozessverhalten von Zschäpe, sich von der ursprünglichen Verteidigungsstrategie, die ihr von den Altverteidigern auferlegt worden sei, getrennt und im Prozess zu ihrer Person umfänglich ausgesagt und zu den ihr vorgeworfenen Taten eine Teileinlassung abgegeben zu haben. Er selbst habe Zschäpe zu diesem Aussageverhalten geraten.
Verteidiger Grasel befasste sich in seinem Plädoyer vor allem mit der rechtlichen Bewertung. Dabei lag sein Schwerpunkt auf der Mittäterschaft, deren Voraussetzungen nicht gegeben seien. Grasel bezog sich dabei auf die jüngere Rechtsprechung des BGH, wonach Mittäterschaft nicht schon im Falle des einseitigen Einverständnisses mit der Tat eines anderen und der Bestätigung eines solchen Einverständnisses gegeben sei. Daran gemessen sei für Zschäpe weder Mittäterschaft bei den Tötungsdelikten noch bei den Raubüberfällten gegeben. Hinsichtlich der Morde stellte Grasel das Argument der Bundesanwaltschaft in Abrede, Zschäpe habe aktiv an der Legendierung der Dreiergruppe mitgewirkt. Auch bei den Raubüberfällen stelle sich der Tatbeitrag der Angeklagten als untergeordnet dar. Insgesamt hob Grasel hervor, dass Zschäpe bei keiner Tat vor Ort war und auch keine Einflussmöglichkeiten auf die Durchführung der Taten gehabt habe. Die von der Bundesanwaltschaft vorgetragenen Argumente berührten nur das von der Angeklagten nicht bestrittene Interesse am Taterfolg, nicht jedoch eine Tatbeteiligung im Sinne von Tatherrschaft und damit keine vom Willen Zschäpes abhängige Durchführung der Taten. Bei der Brandstiftung habe Zschäpe nicht – wie von der Bundesanwaltschaft dargelegt – in der Absicht gehandelt, die Nachbarin Erber oder die sich im Haus aufhaltenden Handwerker in die Gefahr des Todes zu bringen. Grasel sah es ferner nicht als erwiesen an, dass Zschäpe Mitglied einer terroristischen Vereinigung war; sie sei lediglich der Bildung einer kriminellen Vereinigung schuldig.
Danach plädierten die Verteidiger von Carsten Schultze, die Rechtsanwälte Jacob Hösl und Johannes Pausch. Sie hoben zunächst die im Prozess sichtbar gewordene Auseinandersetzung von Schultze mit den ihm vorgeworfenen Taten hervor. Dazu gehöre auch geäußerte Reue, wonach Schultze die Gewissheit habe, dass er durch sein Tun objektiv zu neun rassistisch motivierten Morden beigetragen habe, was ihn sein ganzes Leben begleiten werde. Schultze sei kein ehrgeiziger und überzeugter Träger nationalsozialistischer Ideologie. Es sprächen vielmehr eine ganze Reihe objektiver Umstände gegen eine menschenverachtende innere Einstellung bei ihm. In Bezug auf die angeklagten Taten lägen keine hinreichenden Anhaltspunkte vor, dass Schultze bei der Beschaffung und Übergabe der Tatwaffe auch nur bedingten Vorsatz hinsichtlich der mit ihr begangenen Verbrechen gehabt habe. Deshalb sei Schultze freizusprechen.
Anschließend erhielten die Verteidiger des Angeklagten André Eminger das Wort, die Rechtsanwälte Herbert Hedrich und Michael Kaiser. Sie setzten sich mit dem Tatvorwurf auseinander, dass Eminger durch fünf selbständige Handlungen eine terroristische Vereinigung unterstützt habe, deren Zweck und deren Tätigkeiten darauf gerichtet waren, Morde und gemeingefährliche Straftaten zu begehen, um die Bevölkerung einzuschüchtern und durch ihre Auswirkungen den Staat erheblich zu schädigen. Die Verteidigung beschrieb Eminger als einen „Nationalsozialisten, der mit Haut und Haaren zu seiner politischen Überzeugung“ stehe, auch wenn er sich im Verfahren selbst nicht geäußert habe. Sie hob hervor, dass sie die Gesinnung von Eminger nicht verteidigte und auch nicht versuchte, die angeklagten Taten zu rechtfertigen. Es sei ihre einzige Aufgabe, Eminger gegen die erhobenen Tatvorwürfe zu verteidigen. Sie beklagte, den meisten Verfahrensbeteiligten und den Medien scheine die politische Gesinnung als Tatnachweis auszureichen, weil allein diese Gesinnung die Begehung von Straftaten nach dem Motto impliziere: „Solchen Leuten ist alles zuzutrauen, deshalb bedarf es eigentlich auch keines konkreten Tat- und Schuldnachweises mehr.“ (Ramelsberger, Bd, IV, S. 1746 f.) Eine Unterstützung der terroristischen Vereinigung könne Eminger nicht nachgewiesen werden, da er zum NSU keine solche Nähe gehabt hätte, die eine strafbare Unterstützung der von Böhnhardt und Mundlos begangenen Verbrechen bedeuten könne. Auch die Verteidigung von Eminger verlangte deshalb einen Freispruch.
Danach plädierten die Rechtsanwälte Stefan Hachmeister und Pajam Rokni-Yazdi für ihren Mandanten Holger Gerlach. Dabei betonten sie zunächst den hohen öffentlichen Pönalisierungsdruck, der auf dem Verfahren liege, und wiesen auf das Spannungsverhältnis hin, das für Gerlach bestehe: Einerseits sei ihm bewusst, dass ihm niemand glauben werde. Andererseits verspüre er das Bedürfnis, sich von den Mordtaten abzugrenzen und sichtbar zu machen, dass er diese weder erahnt noch für möglich gehalten, geschweige denn in irgendeiner Weise habe befördern wollen (Ramelsberger, Bd. IV, S. 1755). Die Verteidigung betonte, dass Gerlach sich in der Hauptverhandlung ernsthaft und aufrichtig gegenüber den Opfern und deren Angehörigen dafür entschuldigt hätte, durch sein eigenes Verhalten objektiv dazu beigetragen zu haben, das Unrecht und das Leid der Geschädigten zu vergrößern. Und er habe explizit seine Bereitschaft erklärt, Verantwortung für dieses Verhalten zu übernehmen.
Die Verteidigung bestritt den Vorwurf, Gerlach habe durch drei rechtlich selbständige Handlungen eine terroristische Vereinigung unterstützt und damit dazu beigetragen, dass diese Vereinigung aus dem Untergrund heraus Straftaten gegen das Leben von Menschen verüben konnte. Gerlach habe während seiner gesamten Aussage stets jede Kenntnis und Ahnung in Abrede gestellt, dass Zschäpe sowie Mundlos und Böhnhardt zu irgendeinem Zeitpunkt nach ihrem Untertauchen eine terroristische Vereinigung begründet hatten. Bewiesen worden sei allein Gerlachs Unterstützung einer kriminellen Vereinigung in einem Fall, wofür er auch bestraft werden müsse.
Sodann hielten Rechtsanwalt Olaf Klemke und Rechtsanwältin Nicole Schneiders ihre Plädoyers für den Angeklagten Wohlleben. Zunächst beklagten sie, das Verfahren sei nicht rechtsstaatlich und vor allem nicht fair geführt worden. Wohlleben befinde sich seit sechseinhalb Jahren in Untersuchungshaft. Wäre dieses Verfahren nicht ein solches Politikum, wäre Wohllebens Haftbeschluss längst außer Vollzug gesetzt worden. Die Verteidigung betonte, ihren Mandanten nicht politisch, sondern rein sachlich vertreten zu haben. Rechtsanwältin Schneiders prangerte die Verstrickung des Verfassungsschutzes in die Taten des NSU an, ebenso das Schreddern von Akten durch den Verfassungsschutz. Sie wies auf die Möglichkeit hin, dass der NSU gar ein Konstrukt des Verfassungsschutzes sei. Wohlleben solle Opfer einer Rechtsprechung um jeden Preis werden, Sündenbock für die nicht mehr verfolgbaren Böhnhardt und Mundlos. Das Urteil habe von Beginn an festgestanden. Auch Rechtsanwalt Klemke betonte noch einmal die Vorverurteilung Wohllebens durch die Medien und den dadurch erzeugten Druck auf das erkennende Gericht. Er befasste sich schwerpunktmäßig mit den Aussagen von Carsten Schultze, die Wohlleben schwerwiegend belasteten, weil Schultze behauptet hätte, die von ihm gekaufte Waffe sei die Tatwaffe der sogenannten Ceská-Mordserie gewesen. Die Verteidigung von Wohlleben bestritt jedoch, dass es sich dabei um die Tatwaffe gehandelt habe, und verlangte vom Gericht, Wohlleben freizusprechen.
Rechtsanwalt Klemke griff in seinem Plädoyer die Bundesanwaltschaft wie auch den Verteidiger von Carsten Schultz, Rechtsanwalt Hösl, heftig an (Jüttner), weil dieser sich gegen einen Antrag von Klemke gewandt hatte, den „drohenden Volkstod“ zu beweisen. Ebenso attackierte er Oberstaatsanwalt Weingarten, weil dieser sich einfach zwei oder drei Gegebenheiten aus der Biografie von Wohlleben herausgesucht und diese dann pauschal im Sinne des von ihm gewünschten Ergebnisses interpretiert hätte. Klemke behauptete, Weingarten nehme für sich in Anspruch, zu definieren wer Nazi sei und bezog sich damit auf einen Satz von Hermann Göring „Wer Jude ist, bestimme ich.“ (Ramelsberger, Bd. IV, S. 1780).
Rechtsanwalt Nahrath schloss an die Ausführungen Klemkes an, Täterschaft werde allein schon durch die Ideologie des Nationalsozialismus begründet, oder „gleich bei allem, was als rechtsradikal, rechtsextrem, rassistisch, faschistisch oder ausländerfeindlich oder dergleichen kolportiert wird“ (Ramelsberger, Bd. IV, S. 1783). Er gab in seinem Schlussvortrag einen eindrücklichen Beweis seiner eigenen nationalsozialistischen Gesinnung, indem er einen Ausflug in den „historischen Nationalsozialismus“ unternahm und eine Reihe von Zitaten im Gesamtkontext des Plädoyers zustimmend wiedergab wie das von Lloyd George, dem britischen Premierminister im Ersten Weltkrieg, mit dem die großen Veränderungen des „berühmten deutschen Führers“ hervorgehoben wurden. Es könne kein Zweifel daran bestehen, „dass er eine wunderbare Veränderung im Geist der Menschen vollbracht hat.“ Daran reihten sich Zitate von Hitler, Goebbels, v. Schirach und Hess. Diese Zitate – so Nahrath – seien ein starkes Indiz dafür, dass sich weder Böhnhardt noch Mundlos und schon gar nicht Zschäpe mit dem „historischen Nationalsozialismus“ überhaupt befasst hätten. Der NSU sei gewiss U, aber nicht NS. Rauben und Morden klinge eher nach dem Schema der RAF. Auf Wohlleben bezogen betonte Nahrath, dieser habe die Anwendung von Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele nachdrücklich abgelehnt und sei kein Ausländerfeind. Abschließend befasste Nahrath sich, wie Rechtsanwältin Schneiders, sehr kritisch mit der Rolle des Verfassungsschutzes. Er stellte den Antrag, den Haftbefehl gegen Wohlleben aufzuheben und ihn freizusprechen.
Die „Altverteidiger“ der Angeklagten Zschäpe plädierten in einer Weise, als hätten sie diese den gesamten Prozess über verteidigt, aber nicht als Anwälte, denen Zschäpe das Vertrauen entzogen hatte und von denen sie sich trennen wollte, und schon gar nicht als Anwälte, deren Entpflichtungsanträge das Gericht abgelehnt hatte, weshalb sie sich in einem Großteil des Prozesses in die Rolle von Statisten gedrängt sahen. Ebenso wenig brachten sie in ihren Plädoyers das damit zwangsläufig verbundene Kommunikationshindernis zwischen sich selbst und den Anwälten Grasel und Borchert zum Ausdruck. Die Änderung der Verteidigungsstrategie durch Grasel und Borchert fand sich nur in einer kurzen Bemerkung von Rechtsanwalt Heer in seinem Plädoyer wieder. Heer trug vor, Zschäpe hätte auf den Rat ihrer neuen Verteidiger gehört und sei dabei selbst nicht imstande gewesen, die Risiken bei der Abfassung der Erklärung durch Rechtsanwalt Borchert zu überblicken (Ramelsberger, Bd. IV, S. 1791).
Heer, der als erster der drei „Altverteidiger“ sprach, hob zunächst die seiner Ansicht nach massive öffentliche und justizielle Vorverurteilung Zschäpes hervor. Zschäpe sei in den Medien u.a. als „meistgehasste Frau Deutschlands“ bezeichnet worden, der Vorsitzende des Innenausschusses des Bundestages habe schon im November 2011 von einer „Terrorzelle“ gesprochen, der damalige Generalbundesanwalt Range und der ehemalige Präsident des BKA Ziercke höchstpersönlich hätten Zschäpe öffentlich angeprangert, als die Ermittlungen noch nicht einmal einen Monat geführt worden seien (Ramelsberger, Bd. IV, 1791). Anschließend widmete Heer sich dem Tatkomplex „Inbrandsetzung“ der Wohnung von Böhnhardt und Mundlos, einhergehend mit der Anklage wegen versuchten Mordes der Wohnungsinhaberin Erber sowie der Handwerker P. und K., die sich zum Zeitpunkt der Brandstiftung im Haus befunden hatten. Im Ergebnis verneinte Heer sowohl den Vorwurf des Mordversuches als auch jenen der schweren Brandstiftung. Die Angeklagte habe sich lediglich wegen einfacher Brandstiftung und fahrlässigen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion strafbar gemacht.
Rechtsanwalt Stahl argumentierte, Zschäpe sei zu den fraglichen Tatzeiten an keinem der Tatorte anwesend gewesen und habe auch kein einziges Tatbestandsmerkmal der ihr vorgeworfenen Straftaten eigenhändig verwirklicht. Mittäterschaft sei nach der jüngeren Rechtsprechung des BGH aufgrund einer Gesamtbetrachtung aller Umstände festzustellen. Herangezogen würden „als wesentliche Anhaltspunkte dabei insbesondere der Grad des eigenen Interesses am Taterfolg, der Umfang der Tatbeteiligung und die Tatherrschaft oder wenigstens der Wille zur Tatherrschaft (Ramelsberger, Bd. IV, S. 1798). Dass Zschäpe mit Verbrechern in einer Wohnung zusammengelebt hätte, machte sie noch nicht selbst zur Verbrecherin. Zschäpe habe von den Taten der beiden gewusst, sei aber bei ihnen geblieben und habe sich nicht der Polizei gestellt. Das dürfe allenfalls zu einer Verurteilung wegen Nichtanzeigens geplanter Straftaten gem. § 138 StGB führen, keinesfalls jedoch eine Mittäterschaft wegen Mordes tragen. Stahl setzte sich mit den Argumenten des GBA auseinander, das Nichtpreisgeben der wahren Identität gegenüber den Nachbarn könne als „Legendierung“ angesehen werden und maßgeblich zur Begründung der Mittäterschaft beitragen. Der Vorwurf, Zschäpe habe über 13 Jahre im Untergrund mit Böhnhardt und Mundlos gelebt und sich dabei zum gemeinsamen verschworenen Kampf gegen Immigration und Integration entschieden, sei – so Stahl – „das mit Abstand populärste Argument für die auch in der öffentlichen Wahrnehmung als feststehend angenommene Schuld von Zschäpe“ (Ramelsberger, Bd. IV, S. 1799). Dieses Argument gehe von einem nicht existenten Erfahrungssatz aus, ein Mensch, der über lange Zeit mit Verbrechern zusammenlebe, müsse selbst Verbrecher sein, mindestens aber die Verbrechen der anderen billigen und mittragen. Stahl schloss damit, dass keine der von Böhnhardt und Mundlos begangenen Taten vom Willen Zschäpes abhingen, sondern ausschließlich von den Entschlüssen dieser beiden. Er zitierte dazu den Vorsitzenden des 3. Strafsenats des BGH, jenes Senats, der über etwaige Revisionen zu entscheiden haben werde, mit den Worten: „Es bleibt dabei: Ohne Tatbeitrag keine Mittäterschaft!“ (Ramelsberger, Bd. IV, S. 1802).
Rechtsanwältin Sturm bezog sich vor allem auf die Person Zschäpes, aber auch auf den Vorwurf der Mitgliedschaft in einer kriminellen sowie terroristischen Vereinigung. Sie gelangte insbesondere anhand der Bezugnahme auf verschiedene Zeugen zu dem Schluss, Zschäpe sei keine eiskalte, berechnende Mörderin. An der Gründung einer kriminellen Vereinigung sei sie ebenso wenig beteiligt gewesen, wie sie Mitglied einer solchen war; dies gälte erst recht in Bezug auf eine terroristische Vereinigung, weil der NSU keine solche Vereinigung gewesen sei.
7. Das Urteil
Wie bereits unter 1. erwähnt, wurde das Urteil am 438. Tag des Prozesses, am 11. Juli 2018, verkündet. Zschäpe wurde u.a. als Mittäterin des Mordes in zehn tatmehrheitlichen Fällen, wegen mehrfachen versuchten Mordes, wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Herbeiführung einer schweren Sprengstoffexplosion, besonders schwerer räuberischen Erpressung, versuchten Raubes mit Todesfolge, wegen besonders schweren Raubes, wegen mehrfach begangener versuchter Brandstiftung mit Todesfolge in Tateinheit mit versuchtem Mord und besonders schwerer Brandstiftung als Gesamtstrafe zu lebenslanger Freiheitsstrafe mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld verurteilt. Entgegen dem Antrag der Bundesanwaltschaft sprach das Gericht keine Sicherungsverwahrung aus.
Die Mittäterschaft der Angeklagten Zschäpe trotz Abwesenheit an den Tatorten erblickte der Senat jeweils in ihrer festgestellten – in allen Fällen nahezu wortgleich wiederholten – Zusage, „die Abwesenheitszeiten Uwe Böhnhardts und Uwe Mundlos’ im Zusammenhang mit der Tatausführung zu legendieren, deren Abwesenheit durch ihre eigene Präsenz im Bereich der Wohnung zu tarnen und aktiv bei Nachfragen, jeweils der Situation angepasst, eine unverfängliche Erklärung für deren Abwesenheit zu finden und abzugeben. Sie sagte zu, den beiden Männern eine sichere Rückzugsmöglichkeit in die Zentrale der Vereinigung, also ihre gemeinsame Wohnung, zu schaffen. Sie sagte eine sorgfältige Beobachtung der Umgebung ihrer gemeinsamen Wohnung und Zentrale der Vereinigung zu sowie eine schnelle und umsichtige Reaktion auf Vorkommnisse, die den Eindruck des unauffälligen bürgerlichen Lebens der drei Personen in Frage stellen könnten. Dadurch gab sie Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos die Sicherheit, ungefährdet in die Zentrale der Vereinigung, ihre gemeinsame Wohnung, zurückkehren zu können und ermöglichte auf diese Art und Weise erst die Durchführung dieser Tat vor Ort. […] Dieser von der Angeklagten Zschäpe geleistete Tatbeitrag […] war daher unverzichtbare Bedingung für die Begehung der Tat“ (Urteil. S. 90, 92 f.).
Die Angeklagten Eminger und Gerlach wurden der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung für schuldig gesprochen; Eminger erhielt eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten, Gerlach von drei Jahren. Eminger wurde von den Vorwürfen der Beihilfe zum versuchten Mord, der Beihilfe zu einem Sprengstoffanschlag, der Beihilfe zum Raub und eines Falles der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung freigesprochen. Der Senat ging in diesen Fällen von einem (seinerzeit noch) fehlenden Vorsatz hinsichtlich der jeweiligen Haupttaten des NSU aus, den er erst zum Zeitpunkt späterer Taten gebildet hätte (Urteil S. 2880 ff.). Der Haftbefehl gegen Eminger wurde aufgehoben.
Die Angeklagten Wohlleben und Schultze wurden wegen Beihilfe zu mehreren Fällen des Mordes verurteilt, der Angeklagte Wohlleben zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren, der Angeklagte Schultze zu einer Jugendstrafe von drei Jahren.
8. Die Rechtsmittel
Die Angeklagten Zschäpe, Gerlach, Wohlleben und Eminger ließen durch ihre Verteidigungen Revision einlegen. Der GBA legte gegen den Teilfreispruch Emingers Revision ein.
Ein zentraler Aspekt der Revisionsbegründung Zschäpes war ihre Verurteilung als Mittäterin. Das war dann auch der Schwerpunkt der Begründung des 3. Strafsenats des BGH, die Revision weitgehend zu verwerfen, unter zugleich geringfügiger Veränderung des Schuldspruches. Der BGH stellte klar, dass Zschäpe als gleichberechtigtes Mitglied des NSU an der Tatplanung mitgewirkt und dadurch bestimmenden Einfluss darauf gehabt habe, ob, wann, wo und wie die Taten ausgeführt wurden. Dabei sei vom Oberlandesgericht zu Recht hinsichtlich der Tatherrschaft auf die Bedeutung der von der Angeklagten gemäß dem Vereinigungskonzept erteilten Zusagen abgestellt worden. Insbesondere habe Zschäpe zugesichert, die tatbedingte Abwesenheit ihrer Komplizen zu legendieren. Ab der siebten Tat habe sie das Versprechen abgegeben, das Bekennervideo in der jeweils aktuellen Version zu verbreiten und Beweismittel zu vernichten, die auf die Vereinigung hinwiesen. Beides habe bei jeder einzelnen Tat die Anwesenheit von Zschäpe in der als Zentrale genutzten Wohnung erfordert. Infolgedessen sei die Angeklagte entscheidend dafür verantwortlich, dass das über die Deliktsverwirklichung hinausgehende Ziel der Taten erreicht werden konnte. Ihre Zusagen seien für ihre Komplizen sinnstiftend und handlungsleitend gewesen. Sie habe daher eine wesentliche Funktion ausgeübt, von der das Gelingen des Gesamtvorhabens abhing (BGH StV 2022, 87, 88).
Gegen diese Entscheidung erhob Zschäpe eine Anhörungsrüge und Gegenvorstellungen. Sie rügte insbesondere die Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör, ihres Rechts auf ein faires Verfahren und der Garantie des gesetzlichen Richters. Im Wesentlichen machte sie geltend, die in dem angefochtenen Revisionsbeschluss dargelegte Begründung für die Mittäterschaft weiche von derjenigen im Urteil des Oberlandesgerichts und der Gegenerklärung des GBA ab. Der Senat habe seine Rechtsprechung zur Mittäterschaft in Abweichung von den übrigen Strafsenaten des Bundesgerichtshofs geändert und unterscheide nun nicht mehr zwischen Beteiligungsform und übergeordneten gemeinsamen Zielen der Mitglieder einer terroristischen Vereinigung. Im Hinblick auf den “Schutz vor Überraschungsentscheidungen” habe der Angeklagten die Möglichkeit eingeräumt werden müssen, auf die “nunmehr geänderte” Rechtsauffassung des Senats einzugehen. Die Voraussetzungen für eine Verwerfung der Revision als offensichtlich unbegründet hätten nicht vorgelegen. Zudem hätte die Verpflichtung bestanden, eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union darüber einzuholen, wie der unionsrechtliche “Begriff der ‘kriminellen Vereinigung’ … auszulegen sei”.
Der BGH verwarf die Anhörungsrüge und wies die Gegenvorstellungen als unzulässig zurück. Der Senat hob hervor, er habe bei seiner Entscheidung keinen Verfahrensstoff verwendet, zu dem die Verurteilte nicht zuvor gehört worden sei. Auch habe er zu berücksichtigendes Vorbringen der Verurteilten nicht übergangen. Zschäpe habe im Revisionsverfahren umfangreich zur Frage ihrer mittäterschaftlichen Beteiligung vorgetragen. Der Senat habe diese Rechtsausführungen bei seinen Beratungen gewürdigt, ihnen allerdings aus den im angefochtenen Beschluss dargelegten Gründen nicht beizutreten vermocht. Die Gegenvorstellung erweise sich deshalb als unzulässig, weil es dem Revisionsgericht außerhalb des Verfahrens versagt sei, eine Entscheidung aufzuheben oder zu ändern, mit der es die Rechtskraft des tatrichterlichen Urteils herbeigeführt habe.
Zschäpe legte schließlich noch Verfassungsbeschwerde ein, worin sie die Verletzung ihres Rechts auf rechtliches Gehör, eine willkürliche Anwendung des § 349 Abs. 2 StPO und eine Verletzung ihres Rechts auf den gesetzlichen Richter rügte. Sie machte insbesondere geltend, es verletze sie in ihren durch die Verfassung garantierten Rechten, dass der BGH über ihre Revision durch Beschluss und nicht nach einer mündlichen Verhandlung durch Urteil entschieden habe.
Das BVerfG nahm die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung an, weil es die Annahmevoraussetzungen des § 93a Abs. 2 BVerfGG als nicht erfüllt ansah (2 BvR 2222/21, NJW 2022, 3413). Zschäpe habe weder dargetan noch sei es aus sich heraus ersichtlich, dass sie in ihren Rechten auf die Gewährung rechtlichen Gehörs verletzt ist. Ebenso wenig liege ein Verstoß gegen das aus dem allgemeinen Gleichheitssatz abzuleitende Willkürverbot oder das Gebot der Entscheidung durch den gesetzlichen Richter vor. Die Möglichkeit, im strafrechtlichen Revisionsverfahren eine Revision nach § 349 Abs. 2 StPO durch Beschluss – also ohne vorherige Durchführung einer mündlichen Verhandlung – zu verwerfen, begegne keinen verfassungsrechtlichen Bedenken. Dies stehe auch im Einklang mit Art. 6 Abs. 1 EMRK, wo zwar grundsätzlich die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verlangt werde. In Rechtsmittelverfahren gelte dieser Grundsatz aber nicht uneingeschränkt. Habe in der ersten Instanz eine öffentliche Verhandlung stattgefunden, könne es aufgrund der Besonderheit des betreffenden Verfahrens gerechtfertigt sein, in der zweiten oder dritten Instanz von einer mündlichen Verhandlung abzusehen. Unter Berücksichtigung dieser Maßstäbe sei eine Gehörsverletzung weder dargetan noch aus sich heraus ersichtlich. Dasselbe gelte für die Rüge der Gehörsverletzung im Zusammenhang mit der Rechtsprechung des BGH zur Mittäterschaft. Die Argumentation Zschäpes stehe unter der Prämisse, dass der Bundesgerichtshof – für sie überraschend – von seiner ständigen Rechtsprechung zur Mittäterschaft abgewichen sei. Dies treffe jedoch nicht zu, denn der Beschluss des BGH vom 12. August 2021 entspreche der bisherigen Rechtsprechung zur Abgrenzung zwischen Täterschaft und Teilnahme.
Auch die Revisionen von Gerlach und Wohlleben wies der BGH durch Beschluss als unbegründet zurück.
Hinsichtlich der Revision des GBA und der Verteidigung in Bezug auf den Angeklagten Eminger führte der BGH eine mündliche Verhandlung durch, als deren Ergebnis beide Revisionen durch Urteil verworfen wurden. Zu dem durch den GBA angefochtenen Teilfreispruch führte der BGH u.a. aus, das Revisionsgericht habe es grundsätzlich hinzunehmen, wenn das Tatgericht den Angeklagten freispreche, weil es auf der Grundlage einer Gesamtbewertung aller Umstände des Einzelfalls Zweifel an der subjektiven Tatseite nicht zu überwinden vermag. Die Beweiswürdigung sei vom Gesetz dem Tatgericht übertragen (§ 261 StPO). Es obliege allein ihm, sich unter dem umfassenden Eindruck der Hauptverhandlung ein Urteil über die Schuld des Angeklagten zu bilden. Seine Schlussfolgerungen brauchten nicht zwingend zu sein; es genüge, dass sie möglich seien. Die revisionsgerichtliche Prüfung beschränke sich darauf, ob bei der Beweiswürdigung ein Rechtsfehler unterlaufen ist.
In Sachen Wohlleben hatte sich der BGH schließlich noch mit einer weiteren Entscheidung des OLG München zu befassen (BGH StB 43/22, NJW 2022, 3729). Wohlleben stand nach der Rechtskraft seiner Verurteilung im NSU-Verfahren kurz vor Verbüßung von zwei Dritteln seiner zehnjährigen Strafhaft. Aufgrund dessen stellte er beim OLG München den Antrag, die Vollstreckung des Strafrests zur Bewährung auszusetzen. Dieser Antrag wurde abschlägig beschieden. Das OLG München setzte zudem eine Frist von sechs Monaten fest, vor deren Ablauf ein erneuter Antrag Wohllebens unzulässig war. Hiergegen hatte er sofortige Beschwerde eingelegt, die der 3. Strafsenat des BGH jedoch verwarf. Der Senat teilte die Ansicht des Oberlandesgerichts, die Aussetzung der Vollstreckung des Strafrests könne unter Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit nicht verantwortet werden. Für Wohlleben könne keine hinreichend günstige Legalprognose gestellt werden.
9. Wirkung und zeitgenössische Bewertung
Der Prozess fand sowohl in der (medialen) Öffentlichkeit als auch in der Rechtswissenschaft große Beachtung. Dabei sind die Auffassungen zwiespältig. Eine Auffassung geht davon aus, das NSU-Verfahren habe sein Ziel erreicht. Friedrichsen schreibt dazu, dass der Rechtsstaat „dank der exorbitanten Leistung des Senats und seines Vorsitzenden die Nagelprobe bestanden (habe), ein differenziertes, um Wahrheit und Gerechtigkeit bemühtes Urteil zu fällen, das der Bedeutung des Falles entspricht. Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe waren gleichsam die Vorboten einer erstarkten rechtsextremen Bewegung, die sich anheischig macht, an den Grundfesten der europäischen Demokratien zu rütteln. Ihr Einhalt geboten zu haben unter Wahrung des Rechts der Angeklagten auf ein faires Verfahren, unter Einhaltung der strengen Regeln eines institutionalisierten Prozedere, in dem sich mehrere ‚Parteien‘ im Kampf um die Wahrheit gegenüberstehen und so lange miteinander streiten, bis sich am Ende eine tragfähige richterliche Überzeugung bildet, ist das große Verdienst des NSU-Prozesses“ (Friedrichsen, S. 294 f.).
Demgegenüber wird beispielsweise von NSU-Watch und anderen Prozessbeobachtern beklagt, der Rechtsstaat habe die Opfer des NSU-Terrors im Stich gelassen. Auch das schriftliche Urteil des OLG München trage nichts zur Wahrheitsfindung im NSU-Komplex bei. Es sei formelhaft, ahistorisch und kalt. Der Umfang von 3025 Seiten solle verschleiern, dass der Senat unter Vorsitz von Manfred Götzl seiner Aufgabe der Wahrheitsfindung und der Wiederherstellung des Rechtsfriedens nicht gewachsen gewesen sei (NSU-Watch, S. 208 f.). Von der überwiegenden Zahl der Nebenkläger wurde und wird massiv kritisiert, dass die Bundesanwaltschaft den Fokus der Anklage allein auf die sogenannte „Trio-Täterschaft“ (oder auch „Einzeltäter-These“) gelegt und die Aufmerksamkeit der Strafverfolger sich nicht auf das Umfeld des NSU gerichtet habe. Dazu gehört auch der Vorwurf, die Aufklärung des Tatgeschehens habe nicht auch der Rolle des Verfassungsschutzes gegolten, ein Vorwurf, der sich von Seiten der der Nebenklagevertreter genauso gegen die Beweisaufnahme durch das Gericht richtete (Förster/Moser/Selvakumaran [Hg.]). Parallelen zum RAF-Verfahren werden insoweit gesehen, als ein verbindendes Element in der Kooperation staatlicher Stellen mit Terroristen oder mit diesen nahestehenden Personen bestünde (Buback, in: Förster/Moser/Selvakumaran [Hg.], S. 188 ff., 190).
In der Rechtswissenschaft wird diskutiert, ob der NSU-Prozess ein politischer Prozess war, wobei bislang keine klare Antwort gefunden worden ist, sondern auf die Schwierigkeit hingewiesen wird, eine solche zu geben.
Allerdings wird auch vor einer „künstlichen Entpolitisierung“ des NSU-Prozesses gewarnt (Liebscher, NSU-Komplex). Das hängt aber mit dem generellen Problem zusammen, dass für die Einordnung eines Strafverfahrens als politisches bzw. einer politischen Strafjustiz nach wie vor keine eindeutige Definition existiert, sondern darüber gestritten wird (s. Arnold, Strafgesetzgebung und ‑rechtsprechung als Mittel der Politik, S. 86 f.). Groenewold beschreibt die beiden grundlegenden – sich konträr gegenüberstehenden – Ansichten so: „Einmal diejenige, die den Begriff auf Verfahren beschränkt, die gegnerische oder kritische Meinungsäußerungen zum Gegenstand haben, sowie auf Hochverratsprozesse. Zum anderen die, jeder Strafprozess als solcher sei politisch insofern, dass er der Bestätigung bzw. Infragestellung von Gesetzen oder einer bestimmten gesellschaftlichen Ordnung dient.“ (Groenewold, Editorial). Allerdings gibt es eine Reihe von Auffassungen, die sich diesen beiden Grundanschauungen eben gerade nicht ohne weiteres zuordnen lassen. Das trifft in gewisser Weise auch für die übereinstimmenden Positionen der beiden Autoren des hier vorgelegten Textes über das NSU-Verfahren zu. Es lässt sich eben nicht eindeutig beantworten, ob das NSU-Verfahren ein politischer Prozess war oder nicht. Gleichwohl kann eine Annäherung an Berührungspunkte des Politischen von bestimmten Ordnungskreisen her erfolgen. Der erste dieser Ordnungskreise betrifft die Frage, ob der Prozess vom Anklagevorwurf her politisches Handeln der Angeklagten thematisiert. Der zweite Ordnungskreis betrifft die Gestaltung des Verfahrens durch die in ihm handelnden Akteure. Hier steht die Frage im Mittelpunkt, ob der Prozess von den unterschiedlichen Akteuren in einem politischen Kontext geführt wird. Der dritte Ordnungskreis schließlich fragt nach politischen Folgen und Folgerungen. Diese können, müssen aber nicht durch die Akteure intendiert sein (Heghmanns, Das NSU-Verfahren).
Mithin ist es sinnvoll, einzelne Aspekte des NSU-Verfahrens auf ihre jeweilige politische Dimension hin zu untersuchen. Oberlandesgericht und GBA haben ganz offensichtlich versucht, eine Politisierung des Verfahrens durch eine Konzentration auf den strafrechtlichen Verfahrensstoff zu verhindern. Ob man solche Verhinderungsversuche bereits als politischen Akt der Verfahrensführung begreifen kann, erscheint fragwürdig, will man den Begriff des Politischen nicht banalisieren. Gleichwohl ist nicht zu leugnen, dass gerade die Tatvorwürfe selbst eine politische Dimension aufwiesen und der Prozess unzweifelhaft auch eine politische Wirkung hatte.
In der Gesamtschau dieser Aspekte gelangt man vor dem Hintergrund des Fehlens einer überzeugenden und allgemeintauglichen Definition des Begriffs eines politischen Prozesses schließlich zu einer differenzierenden Einschätzung: Zweifellos „weist das NSU-Verfahren einige gewichtige politische Aspekte auf. Allerdings handelt es sich ebenso zweifellos um keinen idealtypischen politischen Prozess“ (Heghmanns, Das NSU-Verfahren). Zu einem anderen Resultat gelangt man mit den Maßstäben von Kirchheimer und insbesondere von Groenewold (Kirchheimer, Politische Justiz; Groenewold, Als Strafverteidiger in Stammheim). Groenewold zieht in seiner Einführung bei der öffentlichen Vorstellung der von Jeßberger und Schuchmann herausgegebenen Stammheim-Protokolle auch Vergleiche mit den NSU-Verfahren und legt dar, dass das NSU-Verfahren hinsichtlich einiger Anträge und ihrer Behandlung dem Muster Stammheim gefolgt sei. Das gelte für die Eingangsanträge der Verteidiger, die sich gegen die Vorverurteilung und Aktenverweigerung richteten, das gelte aber auch für die Entscheidungen des Gerichts, keine Akten von Untersuchungsausschüssen und des Verfassungsschutzes heranzuziehen, um nicht im Prozess die möglicherweise bestehende Anwesenheit (und vielleicht Unterstützung) von Mitgliedern des Verfassungsschutzes bei den einzelnen Taten erörtern zu müssen (Groenewold, Als Verteidiger in Stammheim).
Legt man den Fokus der näheren Befassung mit der Frage nach dem politischen Strafverfahren vor allem auf die Akteure der Verteidigung in der Hauptverhandlung (Arnold, Entwicklungen der Strafverteidigung, S. 115 ff.), ergibt sich für das NSU-Verfahren die Schlussfolgerung, dass insbesondere die Verteidigung Wohllebens diesen Prozess – entgegen ihrer anderweitigen Beteuerungen – als einen politischen verstanden und in diesem Sinne auch gehandelt hat. Es war ein Verteidigeragieren auf der Stufe der nationalsozialistischen Gesinnung Wohllebens. Insofern muss die berechtigte Frage, ob die politische Verteidigung Wohllebens eher aus taktischen Gründen erfolgte, wohl verneint werden [(vgl. oben 5.3., 6.c)].
10. Würdigung
a) Normative und rechtspolitische Schlussfolgerungen
Aus den oben bei 8. erfolgten Darlegungen ergeben sich bereits die unterschiedlichen Richtungen und Kontroversen bei der Würdigung des Prozesses. Sie wäre aber unvollständig, würde nicht auch auf normative und rechtspolitische Schlussfolgerungen hingewiesen, die teilweise bereits während des NSU-Prozesses, aber nicht zuletzt auch auf Grund der Aufklärungsarbeit der NSU-Untersuchungsausschüsse gezogen wurden:
- Verändert wurde die Rechtsextremismus-Datei. Durch das „Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung des Rechtsextremismus“ soll der Informationsaustausch zwischen den Sicherheitsbehörden verbessert werden, wozu die Einrichtung einer beim BKA angesiedelten Datei dienen soll, um die sicherheitsbehördlichen Informationen zum gewaltbezogenen Rechtsextremismus zu bündeln (Regierungsentwurf, BT-Drs. 17/8672, S. 10 ff., Pichl, S. 292).
- Eine weitere Empfehlung des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestages stellte das „Gesetz zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Bereich des Verfassungsschutzes“ dar. Nunmehr soll das Bundesamt für Verfassungsschutz unbeschadet der Auswertungsverpflichtungen der Landesbehörden zentral alle Erkenntnisse über Bestrebungen und Tätigkeiten auswerten, die „beispielsweise die freiheitlich-demokratische Grundordnung durch den Einsatz von Gewaltmitteln gefährden“ (Pichl, S. 296).
- Im Bereich des Einsatzes von V‑Personen und verdeckten Ermittlern kam es zu erheblichen Veränderungen am bisherigen Verfassungsschutzgesetz. Ob diese tatsächlich die Probleme angehen, die im NSU-Komplex aufgetaucht sind, oder diese nicht sogar teilweise verschärfen, bleibt fraglich (Pichl, S. 297).
- Verbessert werden soll die parlamentarische Kontrolle der Geheimdienste. Die wesentliche Änderung durch das „Gesetz zur weiteren Fortentwicklung der parlamentarischen Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes“ besteht in der Einführung des „Ständigen Bevollmächtigten“ für das Parlamentarische Kontrollgremium (Pichl, S. 300).
- Geändert wurde im GVG die Zuständigkeit des GBA. Unter anderem betraf das die Herabsetzung der Zuständigkeitsvoraussetzungen für Staatsschutzdelikte. (§ 142 a Abs. 1 S. 2 GVG) Ferner reicht nunmehr die objektiv staatsschutzfeindliche Tat aus. (§ 120 Abs. 2 Abs. 1 S. 3 GVG) Diese und andere Erweiterungen der Zuständigkeiten des GBA hingen vor allem damit zusammen, dass der NSU-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages sich vor Aufdeckung des NSU am 4.11. 2011 nicht für zuständig erachtete (von Eitzen, S. 287 ff.).
- Aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung von Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages vom 12.6.2015 wurde § 46 Abs. 2 Satz 2 StGB geändert. Bei den für die Strafbemessung zu berücksichtigenden Zielen und Beweggründen wurde die Formulierung „insbesondere auch rassistische, fremdenfeindliche oder sonstige menschenverachtende“ eingefügt. Damit sollen derart motivierte Gewalttaten einen besonderen Stellenwert im Strafrechtssystem erhalten, was jedoch in der Strafrechtswissenschaft auf Kritik wegen des Symbolhaften dieser Ergänzung stößt (von Etzen, S. 307 ff., mit zahlreichen Nachweisen kritischer Stimmen in dort. Fn. 1401/1402 u.a. von Rosenau, Radtke, Bertram, Hörnle; Pichl, S. 295).
- In strafprozessualer Hinsicht erfuhren die bisherige Frist zur Begründung der Revisionsbegründung in § 345 Abs. 1 S. 1 StPO eine Änderung wie auch die Regelungen zur Nebenklage durch die Einführung von § 397b StPO.
Die Frist zur Begründung einer Revision betrug nach § 345 StPO a.F. einen Monat nach Zustellung des Urteils, gleichviel, wie lange sich nach § 275 StPO das Gericht Zeit zur Fertigstellung des Urteils nehmen konnte. Im NSU-Verfahren standen dem Oberlandesgericht auf diese Weise 93 Wochen zur Verfügung, während die Verteidiger nur einen Monat Zeit hatten, die 3025 Seiten des Urteils auf Fehler durchzusehen und danach ihre Revisionsbegründung zu verfassen. Nach der Neufassung von § 345 StPO bleibt die bisherige Frist zwar im Grundsatz erhalten. Sie verlängert sich aber um einen Monat, wenn das Urteil später als einundzwanzig Wochen nach der Verkündung zu den Akten gebracht worden ist, und, wenn es später als fünfunddreißig Wochen nach der Verkündung zu den Akten gebracht worden ist, um einen weiteren Monat. Eingebettet ist diese Gesetzesänderung in das „Gesetz zur Fortentwicklung der Strafprozessordnung und zur Änderung weiterer Vorschriften“ vom 26.6.2021. Auch wenn in der Gesetzesbegründung kein expliziter Zusammenhang zum NSU-Prozess hergestellt, sondern nur von Umfangsverfahren gesprochen wird (Regierungsentwurf, BT-Drs. 19/27654, S. 98), kann davon ausgegangen werden, dass das NSU-Verfahren nochmals bewusst gemacht hatte, wie schwierig es für die Verteidigung ist, bei solch langen und komplexen Verfahren innerhalb einer strikten Monatsfrist eine Revision unter Beachtung der dafür gesetzlich geregelten inhaltlichen Anforderungen zu begründen. Gerade im Zusammenhang mit den Revisionen im NSU-Verfahren wurde dieser Aspekt, der einer gesetzlichen Einschränkung der Rechte erstinstanzlich Verurteilter gleichkam, von den Verteidigern der Angeklagten besonders betont.
In einem Verfahren können mehrere Verletzte als Nebenkläger auftreten. Eine Obergrenze sieht das Gesetz nicht vor. In Einzelfällen führt das zu erheblichen Schwierigkeiten rechtlicher und tatsächlicher Natur (Allgayer, in: KK, 9. Aufl., Vorbem. zu § 395 StPO). Das zeigte sich besonders im NSU-Prozess, an dem zeitweise über 80 Nebenklagevertreter mitwirkten. Aus dieser Erfahrung heraus wurde mit einem neuen § 397b StPO eine Vorschrift geschaffen, wonach es nun möglich ist, mehreren Nebenklägern nur noch eine Person als Nebenklagevertreter zu bestellen. Mit dieser Bündelung wird das Ziel verfolgt, eine effektive Durchführung der Hauptverhandlung zu erleichtern. Die Einführung von § 397b StPO erfolgte mit dem „Gesetz zur Modernisierung des Strafverfahrens“ vom 10.12.2019.
- Eine weitere strafprozessuale Lehre, letztlich auch aus dem NSU-Prozess, besteht in den nunmehr verstärkten kriminalpolitischen Bemühungen um die Dokumentation der Hauptverhandlung. Obwohl das bisher schon unter bestimmten Voraussetzungen möglich war und auch im NSU-Verfahren möglich gewesen wäre, wurde dies dort sowohl von der Bundesanwaltschaft wie auch vom erkennenden Senat trotz entsprechender Anträge von Verteidigern wie Nebenklagevertretern mit nicht in jeder Hinsicht überzeugenden Argumenten abgelehnt.
Im November 2022 legte Justizminister Buschmann den Entwurf eines sog. “Hauptverhandlungsdokumentationsgesetzes” vor. Dieser bestimmte, eine Hauptverhandlung, die erstinstanzlich vor dem Oberlandesgericht oder dem Landgericht stattfindet, in Zukunft in Bild und Ton aufzuzeichnen. Ferner besagte der Entwurf, dass die Tonaufzeichnung zusätzlich mittels einer Transkriptionssoftware automatisiert in ein Textdokument übertragen werden muss. Rund 600 Gerichtssäle müssten dafür mit der entsprechenden Technik ausgestattet werden. Insbesondere von Seiten der Richterschaft, Staatsanwaltschaften und Justizverwaltungen erfuhr dieses Vorhaben heftige Kritik. Zustimmung dagegen kam von den Strafverteidigerverbänden. Daraufhin legte Buschmann einen Kompromissvorschlag vor. Danach soll die Videoaufzeichnung nur noch optional sein. Außerdem sollen die Justizbehörden der Länder mehr Zeit als ursprünglich geplant erhalten, um die Technik für Tonaufzeichnung und Transkription zu beschaffen. Der Deutsche Anwaltsverein kritisiert das mit den Worten: “Eine Kompromisslösung, die sich nur mit einer bloßen Tonaufzeichnung begnügt, würde die Chance vertun, hier wirklich etwas im Sinne der bestmöglichen Wahrheitsfindung zu verändern.” Schließlich sei der überwiegende Anteil menschlicher Kommunikation nonverbal. Mimik, Gestik, Körperhaltung, Blicke – all dies gehöre zur Würdigung einer Aussage dazu (LTO-Redaktion). Die Diskussion darüber, die auch mögliche Auswirkungen auf das Verhalten von Zeugen und das Rechtsmittelsystem zu bedenken hat, ist nicht abgeschlossen und es ist unklar, ob und wann das Gesetz erlassen wird.
b) Die NSU-Untersuchungsausschüsse im Allgemeinen
Der NSU-Prozess konnte die großen Erwartungen insbesondere der Hinterbliebenen der Opfer des NSU im Hinblick auf umfassende Aufklärung des Geschehens, des Umfeldes sowie der Verstrickungen des Verfassungsschutzes nicht erfüllen. Es ist in der Tat fraglich, ob eine solche Erwartungshaltung mit einem Strafprozess und seinen Grenzen überhaupt bedient werden kann (Arnold StV 2022, 108). Gleichwohl wird darauf hingewiesen, dass für das OLG München aufgrund der Rechtsprechung des EGMR eine Aufklärungspflicht hinsichtlich der Verstrickungen des Staates (hier des Verfassungsschutzes) bestand hätte, welcher der 6. Strafsenat des OLG München nicht nachgekommen sei (Schüler; Arnold StV 2022, 108, 117).
Auch jene Stimmen sind beachtenswert, die sich von der Verhandlungsführung, der Öffentlichkeitsarbeit des Gerichts wie auch dem Urteil erhofften, dass den Nebenklägern ein größeres Gewicht zukommt und sie nicht nur durch die Nebenklagevertreter, sondern auch durch Bundesanwaltschaft und vor allem durch das Gericht im Prozess sichtbar gemacht werden. Das ist nicht erfolgt. Ihnen allein die Möglichkeit zu geben, sich im Prozess zu äußern, reiche dafür nicht aus. Dass es anders geht, konnte die Vorsitzende Richterin in dem Verfahren gegen den Halle-Attentäter zeigen (Arnold, StV 2022, 108, 117 Fn. 118).
Wegen der rechtsstaatlichen Grenzen, die dem Gericht bei der Aufklärung des umfassenden Geschehens durch das Gesetz vorgezeichnet sind, war es umso wichtiger, parlamentarische NSU-Untersuchungsausschüsse zu bilden. Es ist bemerkenswert, dass in den Quellen, die sich mit dem NSU-Prozess befassen, die NSU-Untersuchungsausschüsse soweit ersichtlich kaum vorkommen, mithin auch nicht die Frage nach eventuellen Querverbindungen aufgeworfen wird (mit Ausnahme von Pichl, S. 214 ff.).
Insgesamt gab bzw. gibt es 14 NSU-Untersuchungsausschüsse, davon zwei des Deutschen Bundestages, die anderen parlamentarischen Untersuchungsausschüsse wurden in einer ganzen Reihe von Bundesländern eingesetzt, teilweise in aufeinanderfolgenden Legislaturperioden.
Wenn man die Ergebnisse der Arbeit der NSU-Untersuchungsausschüsse im Hinblick darauf betrachtet, inwiefern sie über die Aufklärung durch den 6. Strafsenat des OLG hinausgehen, so handelt es sich u.a. um die folgenden Feststellungen, wobei vorauszuschicken ist, dass eine idealtypische Grenzziehung zwischen den politischen Dimensionen eines Tatkomplexes, den parallel zu einem Gerichtsverfahren in parlamentarischen Untersuchungsausschüssen erlangten Erkenntnissen und der juristischen Wahrheitsfindung vor Gericht nicht aufrechterhalten lässt (Liebscher, NSU-Komplex).
- Die Analyse der Verfassungsschutzbehörden in Bund und Ländern zur rechtsterroristischen Gefahr war falsch und grob verharmlosend. Hier bestand eine Diskrepanz gegenüber dem tatsächlichen Wissen, das die Verfassungsschutzämter durch ihr engmaschiges V‑Leute-System aus der rechten Szene abschöpfen konnten (Pichl, S. 284 f.).
- Die Abschlussberichte der NSU-Untersuchungsausschüsse zeigen, wie Exekutivbehörden ein Selbsterhaltungsinteresse ausbilden, das gerade kein einheitliches Vorgehen der Staatsapparate hervorbringt, sondern Konflikte, die intra-institutionell zwischen den Staatsapparaten verlaufen. Vor allem die Verfassungsschutzämter zeigten ein Selbsterhaltungsinteresse, das zu einer höchst selektiven Informationsweitergabe an andere Behörden geführt hatte (Pichl, S. 286).
- Wenn alle den Sicherheitsbehörden bereits 1998 und 1999 vorliegenden Informationen zum untergetauchten Kerntrio des NSU richtig ausgewertet, analysiert und bei der Zielfahndung zusammengefasst worden wären, hätte die Mordserie des NSU durch Auffinden von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe verhindert werden können (Pichl, S. 287).
- Die Arbeit der NSU-Untersuchungsausschüsse hat deutlich gezeigt, wie der Einsatz von V‑Personen die rechtsextreme Szene in entscheidender Weise durch mittelbare Finanzierungshilfen, Quellenschutz und Schutz vor Strafverfolgung mit aufgebaut hat (Pichl, S. 288). Über die Quantität und Qualität des V‑Leute-Systems konnte kein abschließendes Urteil gefällt werden, weil auch den Untersuchungsausschüssen das Ausmaß dieses Systems nicht zugänglich gemacht wurde.
Trotz der Tätigkeit der Parlamentarischen Untersuchungsausschüsse wird eingeschätzt, dass die Aufklärung partiell gescheitert ist. In den Behörden, vor allem auch in der Polizei gebe es eine enorme Haltung der Verweigerung, aus dem NSU Konsequenzen zu ziehen. „Wagenburgmentalität“ und „Unfehlbarkeitsparadigma“ setzten sich auch nach den zahlreichen NSU-Untersuchungsausschüssen fort. Es lasse sich insgesamt feststellen, dass die Sicherheitsbehörden, deren spezifische Strukturen zum NSU-Komplex in erheblicher Weise beigetragen und die auch die Aufarbeitung der Mordserie in den Untersuchungsausschüssen und vor Gericht sabotiert hätten, „letztendlich gestärkt aus dem politischen Skandal hervorgegangen sind“ (Pichl, S. 304; Nübel, S. 100–131; Gengnagel/Kallert, S. 158–184). Freilich muss man wohl einsehen, dass daran auch der 6. Strafsenat des OLG München nichts hätte zu verändern vermocht, wenn er die Aufklärung auf die Verstrickung des Verfassungsschutzes erstreckt hätte, ganz abgesehen davon, ob er überhaupt zu derartigen Erkenntnissen wie die NSU-Untersuchungsausschüsse hätte gelangen können. Das Oberlandesgericht München hätte nicht die Aufklärung durch die Untersuchungsausschüsse ersetzen können. Das ändert aber nichts an der unter 6. b) dargestellten Kritik am 6. Strafsenat dieses Gerichts, dass nach der Rechtsprechung des EGMR Rechtspflicht ist, auch die Tatumstände – wie die Unterstützung bei der Auswahl des Tatorts oder bei der Durchführung der Tat – sowie die Kenntnisse staatlicher Behörden von Tätern und Tat aufzuklären und zu berücksichtigen.
Im Ergebnis gesellschaftlich und politisch fatal ist sicherlich die unterbliebene Aufklärung der Rolle der Inlandsgeheimdienste in dem gesamten NSU-Komplex. Dabei darf aber nicht übersehen werden, dass dem Gericht bei solcher Aufklärung deutliche Grenzen gesetzt gewesen wären, wie die Verweigerung sowohl der Herausgabe von Akten des Verfassungsschutzes als auch die Vernehmung von Angehörigen der Behörde als Zeugen. Gerade die darauf gerichteten Aufklärungsbemühungen der Untersuchungsausschüsse haben gezeigt, wie letztlich der Staat alles versucht hat, um solche Aufklärung zu verhindern. Eine Schlussfolgerung aus diesem Dilemma kann eigentlich nur darin bestehen, dass das Recht den Verfassungsschutz zukünftig zur Aufklärung von Verstrickungen in derartige Verbrechen zwingt.
c) Der Bayerische NSU-Untersuchungsausschuss II im Besonderen
Besondere mediale Aufmerksamkeit hat der zweite bayerische Untersuchungsausschuss mit einer achtstündigen Vernehmung von Beate Zschäpe am 22.5.2023 erzielt, die in der Justizvollzugsanstalt Chemnitz stattfand. Zschäpe hat dort erstmals auf Fragen direkt geantwortet, eine Mitschuld an den Taten des NSU eingeräumt, aber zugleich das Bild einer abgeschotteten Dreiergruppe ohne breite aktive Unterstützer im Hintergrund aufrechterhalten (Litschko, Zschäpe verneint Tatorthelfer; https://www.sueddeutsche.de/bayern/beate-zschaepe-nsu-bayern-landtag-ausschuss-mordserie‑1.5875418?print=true – zuletzt aufgerufen: 21.8.2023).
Auf der Pressekonferenz des Ausschusses wurde hervorgehoben, dass die Erwartungen sehr offen waren, weil nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden konnte, dass Zschäpe überhaupt aussagt (im Einzelnen zur Pressekonferenz bei Moser, Rätsel Zschäpe).
Anhand des Protokolls der Vernehmung werden die Aussagen von Zschäpe mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung wiedergegeben (https://www.bayern.landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen/pressemitteilungen-2023/wortlautprotokoll-der-vernehmung-von-beate-zschaepe-im-untersuchungsausschuss-nsu-ii/ – zuletzt aufgerufen: 21.8.2023): Sie gäbe sich geläutert, stelle sich anders als im Prozess nicht mehr als Opfer dar und schließe weitere Mordopfer nicht aus. Hervorgehoben wird ferner, dass sie als Motiv für die Morde nun „Rassenhass“ nennt, während sie im Verfahren selbst bestritten habe, die wahren Motive von Mundlos und Böhnhardt zu kennen. Auch sei anders als im Gerichtsprozess keine Rede mehr von einer Abhängigkeit zu den beiden Uwes. Zschäpe sei dabeigeblieben, die Morde nicht gewollt zu haben und weder an der Planung noch an der Durchführung beteiligt gewesen zu sein. Inzwischen habe sie aber verstanden, dass sie vollumfänglich mitschuldig an den Morden sei. Zschäpe habe sich als „Aussteigerin“ aus der rechtsextremen Szene bezeichnet und wolle in der Haft an einem Aussteigerprogramm teilnehmen (zum Ganzen Ramm, Zschäpe schließt weitere Mordopfer nicht aus). Hingewiesen wird ferner auf ihre Aussage, sie hätte verhindern können, dass aus dem ersten Mord eine Serie wird, wenn sie sich rechtzeitig gestellt hätte (https://www.sueddeutsche.de/bayern/extremismus-muenchen-zschaepe-im-wortlaut-ich-bin-mitschuldig-an-den-morden-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101–230705-99–297513 – zuletzt aufgerufen: 21.8.2023). Dass Zschäpe zu den Morden, die dem NSU zur Last gelegt worden sind, vor dem Ausschuss so gut wie keine Angaben machen konnte, wird entgegen anderen Schlussfolgerungen dahingehend interpretiert, dass es noch andere Verantwortliche für die Morde als nur Böhnhardt und Mundlos gegeben haben könnte. Ferner seien die Aussagen von Zschäpe Anlass, weitere kritische Fragen über die Rolle des Verfassungsschutzes zu stellen. Zschäpe schilderte, nach dem Untertauchen des Trios habe der V‑Mann Brandt wiederholt mit ihnen telefoniert. Die Gespräche seien von Telefonzellen aus geführt und Termine sowie Rufnummern vorher ausgetauscht worden. Dass Brandt V‑Mann war, hätten sie zu dieser Zeit noch nicht gewusst. Nach seiner Enttarnung sei das Trio sehr irritiert darüber gewesen, dass sie bei dieser Sachlage nicht festgenommen worden seien, denn das wäre eine leichte Polizeiübung gewesen. In der kritischen Berichterstattung dazu wird die Frage gestellt, ob das an Brandt lag, der den Kontakt möglicherweise nicht an den Verfassungsschutz verriet, oder ob der Verfassungsschutz die drei gar nicht habe festnehmen wollen (ausführlich Moser, Was weiß Beate Zschäpe?).
Ein interessanter Aspekt zu einer „Vorfeldverteidigung“ des NSU-Trios ergibt sich aus den Aussagen Zschäpes, sich zu unterschiedlichen Zeiten mit Hilfe von jeweils einem Anwalt den Verfolgungsorganen stellen zu wollen. Zschäpe führt aus, sie habe bei Terminen mit den Anwälten diesen eine Vollmacht unterzeichnet, und die Anwälte hätten daraufhin Kontakt mit der Staatsanwaltschaft aufgenommen. Dort sei ihnen aber gesagt worden, man wolle sich auf keine Vereinbarungen einlassen, weil der untergetauchte NSU ohnehin gefasst werden würde. Aus Äußerungen von Brandt, wonach sie mit einer zweistelligen Zahl an Jahren des Freiheitsentzuges zu rechnen habe – so Zschäpe weiter – habe sie dann geschlussfolgert, dass sie besser nicht zurückkommen sollte (https://www.bayern.landtag.de/fileadmin/Internet_Dokumente/Sonstiges_A/Protokoll_Vernehmung_BZsch%C3%A4pe_V%C3%96_050723.pdf, S. 36 ff. ; 126 ff. – zuletzt aufgerufen am 21.8.2023).
Zieht man dazu das Protokoll der Hauptverhandlung vor dem 6. Strafsenat des OLG München heran, so geht daraus hervor, dass es sich in dem einen Fall um den Rechtsanwalt Dr. Eisenecker, hoher Funktionär der NPD, handelte, der im Jahre 2003 verstorben ist. In ihrer schriftlichen Aussage im Prozess machte Zschäpe konkretere Angaben dazu, wie der Kontakt zwischen ihr und Eisenecker zustande kam, nämlich über Carsten Schultz und Ralf Wohlleben. Zu erfahren ist aus dieser Aussage Zschäpes aber auch – was sie in ihrer Vernehmung durch den Untersuchungsausschuss nicht äußerte –, dass sie sich erst stellen wollte, nachdem Mundlos und Böhnhardt, wie diese das vorgehabt hätten, nach Südafrika geflohen wären (https://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-prozess-die-antworten-von-beate-zschaepe-im-wortlaut-a-1073259.html – zuletzt aufgerufen: 21.8.2023).
Am 157. Verhandlungstag des NSU-Prozesses wurde Norbert Wießner, V‑Mann-Führer von Tino Brandt, dazu vernommen, welche Informationen er von Brandt erhalten habe. Wießner erklärte, er habe über Brandt von den Absichten Zschäpes erfahren, sich zu stellen, falls Böhnhardt und Mundlos nach Südafrika flüchteten. Wiesner führte weiter aus, der Verfassungsschutz wäre sicherlich auf Zschäpe zugekommen, wenn die Pläne, sich zu stellen, konkret geworden wären. Es habe ja kein Haftbefehl gegen Zschäpe vorgelegen, Zschäpe hätte daher jederzeit nach Jena oder ins Elternhaus zurückkommen können (zum Ganzen https://www.nsu-watch.info/2014/11/protokoll-157-verhandlungstag-11-november-2014/ ‑zuletzt aufgerufen: 21.8.2023). Einem Medienbericht ist zu entnehmen, dass sich Rechtsanwalt Eisenecker Anfang März 1999 bei der Staatsanwaltschaft Gera meldete, eine von ihr unterschriebene Vollmacht vorlegte und mitteilte, er vertrete Beate Zschäpe juristisch und beantrage Akteneinsicht. Dies sei jedoch von der Staatsanwaltschaft abgelehnt worden, weil die Akten erst nach Abschluss des Verfahrens einzusehen seien. Danach habe sich Eisenecker nicht mehr gemeldet (https://www.focus.de/panorama/reportage/hilfe-vom-vize-report_id_2360293.html – zuletzt aufgerufen: 21.8.2023).
Aus einer Pressemitteilung zu einer Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Aufklärung der NSU-Aktivitäten und weiterer rechtsterroristischer Strukturen in Mecklenburg-Vorpommern aus dem Jahr 2022 geht hervor, dass noch weiter untersucht werden soll, ob Eisenecker das NSU-Kerntrio persönlich traf und ob im Landesverfassungsschutz Hinweise über seine Einbindung in die Unterstützerstruktur vorlagen. Dafür werde auch die Zusammenarbeit mit dem Thüringer Geheimdienst eine Rolle spielen müssen, der eigens einen Mitarbeiter zur Observation von Eisenecker in den Nordosten entsandte (https://www.dielinke-rostock.de/presse/detail/news/ausmass-der-nsu-unterstuetzung-durch-npd-anwalt-eisenecker-weiter-unklar/ – zuletzt aufgerufen: 21.8.2023).
Soweit Zschäpe davon spricht, noch einen weiteren Anwalt kontaktiert zu haben, so handelt es sich dabei wohl um Rechtsanwalt Thomas Jauch aus Weißenfels in Sachsen-Anhalt, ebenfalls dezidiert ein Anwalt der politisch rechten Szene (Hinrichs, Thomas Jauch). Zschäpe kontaktierte Jauch noch vor Eisenecker. Gegenüber FOCUS erklärte er, Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos seien Anfang 1998 bei ihm aufgetaucht. Er habe schließlich Zschäpes Verteidigung übernommen und eine Vertretungsanzeige an die Polizei in Jena geschickt. Das Schreiben habe den Vermerk enthalten, dass Zschäpe bereit sei, sich zur Sache zu äußern, jedoch nur nach Akteneinsicht. Doch weder Polizei noch Staatsanwaltschaft hätten ihn kontaktiert. Zschäpe sei in den nächsten Monaten noch zweimal bei ihm gewesen. Nach Recherchen von FOCUS stellte sich jedoch heraus, dass sich in den Akten der Staatsanwaltschaft kein Hinweis auf eine Vertretungsanzeige des Anwalts befindet (https://www.focus.de/panorama/reportage/hilfe-vom-vize-report_id_2360293.html – zuletzt aufgerufen: 21.8.2023).
Am 124. Verhandlungstag des NSU-Prozesses wurde Rechtsanwalt Jauch als Zeuge vernommen. Insbesondere sollte er dazu aussagen, ob er Kontakte zu den Angeklagten und zu Böhnhardt und Mundlos in der Zeit vor 1998 und danach hatte. Jauch antwortete, dass er berufliche Kontakte im Rahmen von Mandatsverhältnissen hatte und mache daher nach § 53 StPO von seinem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch. Daraufhin fragte der Vorsitzende Götzl ihn, ob außerhalb von Mandatsverhältnissen Kontakte zu den genannten Personen bestanden. Das wurde von Jauch definitiv verneint (https://www.nsu-watch.info/2014/07/protokoll-124-verhandlungstag-8-juli-2014/ – zuletzt aufgerufen am 21.8.2023). Dennoch erbrachte die Zeugenvernehmung das Bild von einer komplexen anwaltlichen Tätigkeit für den NSU und dessen Umfeld (Scharmer/Stolle, Szene-Anwalt Thomas Jauch).
Vor diesem ganzen Hintergrund ergeben sich bisher keine gesicherten Erkenntnisse dazu, wie konkret der Wunsch Zschäpes, sich zu stellen, wirklich war und welche Rolle die von Zschäpe kontaktierten Verteidiger dabei spielten, dass dieses Vorhaben am Ende nicht umgesetzt wurde.
Was vor dem Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtages keine Rolle spielte, war die Frage, warum Zschäpe sich für das NSU-Verfahren von Rechtsanwälten vertreten ließ, die im Gegensatz zu den Verteidigern im Vorfeld gerade keine rechtsextremistische Gesinnung hatten.
In der Reflektion der Aussagen von Zschäpe vor dem Untersuchungsausschuss wurde auch die Frage gestellt, was die Motive für Zschäpe waren, sich erstmals in dieser Weise zu äußern, insbesondere hinsichtlich des erstmaligen Einräumens ihrer Mitschuld. Dazu werden unterschiedliche Antworten gegeben.
Auf der einen Seite wird anerkannt, dass Zschäpe sich schuldig bekannt habe. Es wird ihre Erklärung hervorgehoben: „Ich bin mitschuldig an den Morden. Auch wenn ich nicht abgedrückt habe, habe ich sie geduldet, und wenn ich mich gestellt hätte, wäre die Serie vorbei gewesen. Ich habe es nicht getan, und deshalb bin ich genauso schuldig, als ob ich abgedrückt habe. Und dadurch trage ich jetzt dieses Urteil.“ Der Ausschussvorsitzende Toni Schuberl sieht darin eine neue Qualität. Zschäpe sei weggegangen von der „juristisch klugen Verteidigungslinie“, die sie im Prozess hatte, habe sich der Wahrheit mehr genähert und klar gemacht, davon gewusst zu haben. Sie habe nach elfeinhalb Jahren Haft geschildert, dass sie die Schuld ganz klar bei sich sehe, so als habe sie abgedrückt. So habe sie es formuliert, und das sei schon ein großer Schritt (Moser, Rätsel Zschäpe, S. 15). Aber auch aus anderen Gründen wird das Schuldeingeständnis für bedeutsam gehalten. Durch die Übernahme der Schuld habe sie eigentlich keinen Grund mehr, etwas zu verheimlichen oder falsch darzustellen. Darin liege der Gradmesser der Wahrhaftigkeit (Moser, Was weiß Beate Zschäpe, S. 3).
Auf der anderen Seite wird kritisiert, dass Zschäpe ihre Rolle bei den Verbrechen des NSU heruntergespielt habe. Ihr „spätes Geständnis“ wird für ein taktisches Manöver gehalten, „um irgendwann Lockerungen im Strafvollzug und die Teilnahme an einem Aussteigerprogramm zu erreichen, wenn sie Reue zeigt.“ (https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2023–07/beate-zschaepe-wortlaut-veroeffentlicht – zuletzt aufgerufen: 21.8.2023).
Zschäpe wurde bei ihrer Vernehmung vor dem Ausschuss von ihrem vierten Pflichtverteidiger aus dem NSU-Verfahren Mathias Grasel als Zeugenbeistand begleitet. Mit ihm hielt sie bei ihrer Vernehmung einige Male Rücksprache. Auch wenn keine Äußerungen Grasels dazu bekannt sind, wie er Zschäpe auf die Vernehmung eingestellt und beraten hat, ist in seiner Tätigkeit als Zeugenbeistand wohl nicht zu Unrecht ein Beitrag darin zu sehen, dass Zschäpe sich in dieser Weise geäußert und dabei auch zu dem Aussteigerprogramm bekannt und angeregt hat, dies in die Vollzugsplanung einzubringen. Das alles ist legitim, auch wenn es mit der Hoffnung verbunden ist, eine Verbesserung von Zschäpes Situation zu erlangen, sei es durch mögliche Lockerungen im Strafvollzug, sei es durch eine Reduzierung der Mindestverbüßungszeit nach § 57a Abs. 1 Nr. 2 StGB, eine Hoffnung, die sich aber keineswegs erfüllen muss. Aber auch das wird Grasel mit Zschäpe besprochen haben. Wenn dabei kein offensichtlich alleiniges taktisches Vorgehen zu sehen ist – und das ist hier nicht zu erkennen – dann ist nicht an den lauteren Motiven der Aussagen zu zweifeln. Auch vorhandene Zweifel an der generellen Glaubwürdigkeit ihrer Aussagen sollten sich aus konkreten Anhaltspunkten ergeben und mangelnde Glaubwürdigkeit nicht von vornherein unterstellt werden. Das gilt selbst für eine Mittäterin an terroristischen Verbrechen wie denen des NSU. Dazu kommt, dass Zschäpe offenbar auch bereit zu sein scheint, sich gegenüber der Bundesanwaltschaft einzulassen. Daran hat diese Zschäpe gegenüber bereits ihr Interesse bekundet.
Mittlerweile wurde bekannt, dass Zschäpes Antrag auf Aufnahme in das Aussteigerprogramm des Landes Sachsen abgelehnt worden ist. Die Begründung habe gelautet, dass es dafür noch zu früh sei. (https://www.spiegel.de/panorama/justiz/beate-zschaepe-nsu-terroristin-soll-von-aussteigerprogramm-abgelehnt-worden-sein-a-c0183296-ed66-43e2-818d-1827f64510e2?sara_ref=re-em-em-sh – zuletzt aufgerufen: 11.10.2023)
Im Gegensatz zu den Aussagen Zschäpes vor dem Untersuchungsausschuss wurden die Aussagen des ebenfalls als Zeugen vernommenen, im NSU-Verfahren verurteilten André Eminger bereits durch den Ausschussvorsitzenden Schuberl für unglaubwürdig befunden. Eminger befindet sich seit einem Jahr im Aussteigerprogramm des Landes Sachsen. Im NSU-Prozess, in dem Eminger schwieg, wurde er von seiner Verteidigung als „Nationalsozialist mit Haut und Haaren“ bezeichnet (s.o. 6.c). Nach Aussage Emingers vor dem Untersuchungsausschuss – was seine ersten Aussagen in dieser Sache überhaupt sind – habe er sich seit 2019 grundlegend gewandelt. Schuberl zog das vor allem deswegen in Zweifel, weil Eminger sich nach wie vor nicht mit den Taten des NSU auseinandergesetzt habe (Rauscher, NSU-Ausschuss) und immer wieder betonte, dass er unpolitisch sei und auch mit dem NSU-Trio, dessen engster Vertrauter er war, nie über Politik gesprochen habe. Wie berichtet wird, habe Schuberl darauf geantwortet, dies sei ein “wiederkehrendes Muster” von Zeugen aus der rechten Szene. Wenn man aus der Szene aussteigt, gehöre es dazu, anzuerkennen, dass man vorher drin war (Sundermann, Von den Morden…).
Nicht unerwähnt bleiben soll hier abschließend, dass an dem mittlerweile vorliegendem Abschlussbericht des Bayerischen NSU-Untersuchungsausschusses vom 10.7.2023 (file:///Y:/Documents/Downloads/0000019652-Schlussbericht.pdf – zuletzt aufgerufen: 21.8.2023) massive Kritik geübt wird. Die Erkenntnisse werden insgesamt als dünn bezeichnet. Die Hauptfrage nach einem bayerischen Unterstützungsnetzwerk sei weder bestätigt noch ausgeschlossen worden. Auch seien keine wesentlichen Erkenntnisse dazu erlangt worden, wie nah die V‑Männer des Verfassungsschutzes am NSU-Netzwerk agiert hätten. Dass man Zschäpe und Eminger durch deren Vernehmungen eine Plattform gegeben habe, wird als „furchtbar“ eingeschätzt, einerseits für die Betroffenen und Hinterbliebenen, andererseits würde damit zum Ausdruck kommen, dass sich der Ausschuss „ausgerechnet von Nazis die Mitwirkung an der Wahrheitsfindung“ versprochen habe (https://www.br.de/radio/br24/sendungen/politik-und-hintergrund/das-ende-der-aufklaerung-zum-abschluss-des-bayerischen-nsu-untersuchungsaussch-100.html – zuletzt aufgerufen: 21.8.2023).
11. Quellen und Literatur
Urteil des 6. Senats des OLG München vom 11. Juli 2018: https://fragdenstaat.de/dokumente/4766-nsu-urteil/
Beschluss des 3. Strafsenats des BGH im Revisionsverfahren Beate Zschäpe: BGH StV 2022, 88.
Beschluss des BVerfG im Verfassungsbeschwerdeverfahren betreffend den „NSU-Prozess“: 2 BvR 2222/21, NJW 2022, 3413.
Arnold, in: Lampe (Hrsg.), Deutsche Wiedervereinigung, Bd. II. Die Verfolgung von Regierungskriminalität nach der Wiedervereinigung, Köln. u.a. 1993, S. 85–98.
Arnold, Gibt es einen „neuen Typus“ des Strafverteidigers in Kontinuität zu „Linksanwälten“? StV 2023, 184.
Arnold, Die »Systemimmanenz« des Beschlusses des 3. Strafsenats des BGH im Revisionsverfahren des NSU-Komplexes zu Beate Zschäpe – Zugleich Anmerkung zu BGH, Beschl. v. 12.08.2021 – 3 StR 441/20; StV 2022, 108.
Arnold, in: Hilgendorf/Lerman/Córdoba (Hrsg.), FS für Sancinetti, Berlin 2020, S. 37–64.
Arnold, Bericht über ein besonderes strafrechtliches Schwerpunktseminar an der Universität Münster: „Der NSU-Strafprozess”, www.zjs-online.com, 3/2020, S. 298–300.
Arnold, Entwicklungen der Strafverteidigung, Rechtsgeschichte und Rechtsgeschehen, 2019.
Arnold/Heghmanns, Fortsetzungsbericht über ein besonderes strafrechtliches Seminar an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster: „NSU-Strafprozess und das Urteil“, www.zjs-online.com, 6/2021, S. 829–833.
Assmann, Zschäpe scheitert mit Anzeige gegen ihre Anwälte, 2015: https://www.deutschlandfunk.de/nsu-prozess-zschaepe-scheitert-mit-anzeige-gegen-ihre-100.html (zuletzt aufgerufen: 21.8.2023).
Baur, Der gute Nazi von Jena, https://taz.de/Ralf-Wohlleben-im-NSU-Prozess/!5504060/ (zuletzt aufgerufen: 13.4.2023).
Buback, in: Förster/Moser/Selvakumeran (Hg.), Ende der Aufklärung, Tübingen 2018, S. 188–211.
Diewald-Kerkmann/Holtey (Hrsg.), Zwischen den Fronten, Berlin 2013.
Frees, in: Förster/Moser/Selvakumeran (Hg.), Ende der Aufklärung, Tübingen 2018, S. 212–218.
Friedrichsen, Der Prozess, München 2019.
Friedrichsen, Zschäpe und ihr neuer Einflüsterer, 2015: https://www.spiegel.de/panorama/justiz/beate-zschaepe-im-nsu-prozess-mit-allen-mitteln-a-1045274.html (zuletzt aufgerufen: 21.8.2023).
Gengnagel/Kallert, in: Förster/Moser/Selvakumeran (Hg.), Ende der Aufklärung, Tübingen 2018, S. 158–184.
Greif/Schmidt, Staatsanwaltschaftlicher Umgang mit rechter und rassistischer Gewalt. Eine Untersuchung struktureller Defizite und Kontinuitäten am Beispiel der Ermittlungen zum NSU-Komplex und dem Oktoberfestattentat, Babelsberg 2018.
Groenewold, in: Drecktrah (Hrsg.), Die RAF und die Justiz, München 2015, S. 105–138.
Groenewold, Editorial zum Lexikon der Politischen Strafprozesse, https://www.lexikon-der-politischen-strafprozesse.de/ (zuletzt aufgerufen: 22.8.2023).
Groenewold, Zeitzeugenbericht, Als Strafverteidiger in Stammheim.
Heghmanns, Das NSU-Verfahren, https://www.stammheim-prozess.de/projekt/veranstaltungen/ (zuletzt aufgerufen: 22.8.2023).
Heitmeyer, Autoritäre Versuchungen. Signaturen der Bedrohung I, 3. Aufl., Berlin 2018.
Heitmeyer/Freiheit/Sitzer, in: Schultz (Hrsg.), Auf dem rechten Auge blind. Rechtsextremismus in Deutschland, Stuttgart 2021, S. 75–93.
Dies., Rechte Bedrohungsallianzen. Signaturen der Bedrohung II, Berlin 2020.
Hinrichs, Thomas Jauch – der Anwalt, den die Nazis vertrauen, https://www.welt.de/politik/deutschland/article129936517/Thomas-Jauch-der-Anwalt-dem-die-Nazis-vertrauen.html (zuletzt aufgerufen: 21.8.2023).
Honecker/Kaleck, in: Kritische Justiz (Hrsg.), Streitbare JuristInnen, Bd. 2, Baden-Baden 2016, S. 557–588.
Jansen, https://www.tagesspiegel.de/berlin/zschape-anwaltin-verlasst-berliner-kanzlei-und-die-stadt-4618546.html (zuletzt aufgerufen: 13.4.2023).
Jeßberger/Schuchmann, Die Stammheim-Protokolle. Der Prozess gegen die erste RAF-Generation, Berlin 2021.
Jeßberger/Schuchmann, Der Prozess gegen Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin, Holger Meins, Jan Carl Raspe,
Deutschland 1975–1977, https://www.lexikon-der-politischen-strafprozesse.de/glossar/baader-andreas-und-ulrike-meinhof-gudrun-ensslin-holger-meins-jan-carl-raspe/ (zuletzt aufgerufen: 19.5.2023).
Jüttner, Die Rechts-Anwälte, https://www.spiegel.de/spiegel/nsu-prozess-verteidiger-von-ralf-wohlleben-gehoeren-zur-rechten-szene-a-1207406.html (zuletzt aufgerufen: 13.4.2023).
Kaufmann, Die Hauptverhandlung als Video, https://www.lto.de/recht/justiz/j/gesetzentwurf-audiovisuelle-dokumentation-hauptverhandlung-strafverfahren-bild-ton-revision/ (zuletzt aufgerufen: 13.4.2023).
Kaleck, in: von der Behrens (Hrsg.), Kein Schlusswort. Nazi-Terror. Sicherheitsbehörden, Unterstützernetzwerk. Plädoyers im NSU-Prozess, Hamburg 2018, S. 7–11.
Kauschanski, Sehr viel gesprochen, wenig gesagt, https://www.spiegel.de/panorama/justiz/beate-zschaepe-was-sagte-die-verurteilte-rechtsextremistin-dem-bayerischen-nsu-ausschuss-a-956cd472-584c-49d3-ac8f-8496e8b85122 (zuletzt aufgerufen: 21.8.2023).
Kirchheimer, Politische Justiz. Verwendung juristischer Verfahrensmöglichkeiten zu politischen Zwecken, Neuwied und Berlin 1965.
Liebscher, in: Karakayalɩ/Kaheveci/Liebscher/Melchers [Hg.], Den NSU-Komplex analysieren, Bielefeld 2017, S. 81–106.
Litschko, Zschäpe verneint Tatort-Helfer, https://taz.de/NSU-Terroristin-vor-U-Ausschuss/!5936558/ (zuletzt aufgerufen: 21.8.2023).
LTO-Redaktion, Videoaufzeichnung nur noch optional, https://www.lto.de/recht/justiz/j/aufzeichnung-bild-ton-strafverfahren-buschmann-kompromiss-video-optional/?utm_source=Eloqua&utm_content=WKDE_LEG_NSL_LTO_Daily_EM&utm_campaign=wkde_leg_mp_lto_daily_ab13.05.2019&utm_econtactid=CWOLT000028082345&utm_medium=email_newsletter&utm_crmid= (zuletzt aufgerufen: 13.4.2023).
Mehlich, Der Verteidiger in den Strafprozessen gegen die Rote Armee Fraktion, Berlin 2013.
Moser, Rätsel Zschäpe – Der bayerische NSU-Untersuchungsausschuss vernahm sie acht Stunden lang, https://overton-magazin.de/top-story/raetsel-zschaepe-der-bayerische-nsu-untersuchungsausschuss-vernahm-sie-acht-stunden-lang/ (zuletzt aufgerufen: 21.8.2023).
Moser, Was weiß Beate Zschäpe? – Die Fragen zu den Morden und Tätern werden größer, https://overton-magazin.de/top-story/was-weiss-beate-zschaepe-die-fragen-zu-den-morden-und-taetern-werden-groesser/ (zuletzt aufgerufen: 21.8.2023).
Moser, CSU-Putsch, https://overton-magazin.de/top-story/csu-putsch-im-nsu-untersuchungsausschuss/ (zuletzt aufgerufen: 21.8.2023).
Müller, in: Drecktrah (Hrsg.), Die RAF und die Justiz, München 2010, S. 95–103.
NSU-Watch, Aufklären und einmischen. Der NSU-Komplex und der Münchener Prozess, Berlin 2020.
Nübel, in: Förster/Moser/Selvakumeran (Hg.), Ende der Aufklärung, Tübingen 2018, S. 100–131.
Pichl, Untersuchung im Rechtsstaat. Eine deskriptiv-kritische Beobachtung der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse zur NSU-Mordserie, Weilerswist 2022.
Ramelsberger/Ramm/Schultz/Stadler, Der NSU-Prozess. Das Protokoll. Bd. I Beweisaufnahme I, Bd. II Beweisaufnahme II, Bd. III Beweisaufnahme III, Bd. IV Plädoyers und Urteil, Materialien, München 2018.
Ramelsberger/Ramm, Reue, Trotz und Propaganda, https://www.sueddeutsche.de/politik/nsu-prozess-zwei-neonazis-ein-reuiger-und-ein-naiver‑1.4003010 (zuletzt aufgerufen: 13.4.2023).
Rauscher, NSU-Ausschuss: Unterstützer gibt sich ahnungslos, https://www.br.de/nachrichten/bayern/nsu-ausschuss-unterstuetzer-gibt-sich-ahnungslos,ThebHg8 (zuletzt aufgerufen: 21.8.2023).
Scharmer/Stolle, Szeneanwalt Thomas Jauch musste heute vor Gericht aussagen, Pressemitteilung, https://www.dka-kanzlei.de/news-reader/szeneanwalt-thomas-jauch-musste-heute-vor-dem-olg-aussagen.html – zuletzt aufgerufen: 21.8.2023).
Schedler, Rechtsterrorismus. Radikale Milieus, Politische Gelegenheitsstrukturen und Framing am Beispiel des NSU, Wiesbaden 2021.
Schminke/Siri (Hg.), NSU-Terror. Ermittlungen am rechten Abgrund. Ereignis, Kontexte, Diskurse, Bielefeld 2013.
Schüler, Die NSU-Terrorserie und die staatliche Ermittlungspflicht, Baden-Baden 2022.
Schultz, NSU. Der Terror von rechts und das Versagen des Staates, München 2018.
Speit, Enttäuschung in der Kanzlei, https://taz.de/Zschaepe-Verteidigerin-verlaesst-Berlin/!5062258/ (zuletzt aufgerufen: 13.4.2023).
Sundermann, Von den Morden will er nichts gewußt haben, https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2023–06/eminger-nsu-ausschuss-bayern (zuletzt aufgerufen: 21.8.2023).
Sundermann, Die Selbstverteidigung der Verteidiger, 2018: https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018–06/nsu-prozess-beate-zschaepe-plaedoyer-verteidigung-heer-sturm-stahl (zuletzt aufgerufen: 22.8.2023).
Quent, Rassismus, Radikalisierung, Rechtsterrorismus. Wie der NSU entstand und was er über die Gesellschaft verrät, 3. überarb. und erw. Aufl., Weinheim 2022.
von der Behrens (Hrsg.), Kein Schlusswort. Nazi-Terror, Sicherheitsbehörden, Unterstützernetzwerk. Plädoyers im NSU-Prozess, Hamburg 2018.
von der Behrens, in: Austermann/Fischer-Lescano/Kaleck u.a. (Hrsg.), Recht gegen Rechts. Report 2020, S. 271–279.
von Eitzen, Rassistische und fremdenfeindliche Gewalttaten in Deutschland vor dem Hintergrund internationaler Vorgaben und Entwicklungen, Berlin 2021.
Wierig, Nazis Inside. 401 Tage NSU-Prozess, Hamburg 2018.
Jörg Arnold und Michael Heghmanns
Oktober 2023
Zitierempfehlung:
Arnold, Jörg/Heghmanns, Michael: „Der NSU-Prozess, Deutschland 2013–2018“, in: Groenewold/ Ignor / Koch (Hrsg.), Lexikon der Politischen Strafprozesse, https://www.lexikon-der-politischen-strafprozesse.de/glossar/der-nsu-prozess/, letzter Zugriff am TT.MM.JJJJ.