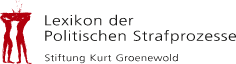Deutschland 1919
Weimarer Republik
Ermordung von Rosa Luxemburg u. Karl Liebknecht
In der Nacht vom 15. auf den 16. Januar 1919 wurden Dr. Rosa Luxemburg und Dr. Karl Liebknecht in Berlin ermordet. Vom 8. bis zum 14. Mai 1919 wurde der Fall vor dem Kriegsgericht der Garde-Kavallerie-Schützendivision verhandelt. Angeklagt waren der Kapitänleutnant Horst von Pflugk-Harttung, der Oberleutnant zur See Ulrich von Ritgen, der Leutnant zur See Heinrich Stiege, der Leutnant zur See Bruno Schulze und der Leutnant der Reserve Rudolf Liepmann des gemeinschaftlichen Mordes an Karl Liebknecht, der Hauptmann Heinz von Pflugk-Harttung wegen Beihilfe zum Mord, sowie der Oberleutnant a. D. Kurt Vogel wegen Mordes an Rosa Luxemburg und der Jäger Otto-Wilhelm Runge wegen Mordversuches an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Verteidiger aller Angeklagten war Fritz Grünspach (Nach dem Wortprotokoll der Hauptverhandlung, BA-MA PH 8‑V/Bd.12, Bl. 19–21). Vorsitzender Richter war der Kriegsgerichtsrat Ehrhardt, einer seiner Beisitzer der Kapitänleutnant Wilhelm Canaris, später der Abwehrchef Adolf Hitlers. Ankläger war der Kriegsgerichtsrat Paul Jorns, später Richter am Volksgerichtshof Roland Freislers. Der Prozess gilt als einer der größten Skandal- ja Vertuschungsprozesse der deutschen Rechtsgeschichte. Dies ergibt sich schon daraus, dass die Täter allesamt, wie der Ankläger und die Richter aus der Garde-Kavallerie-Schützen-Division, einem Freikorps, das vor keiner Gewaltanwendung zurückschreckte, entstammten, während die Opfer von den Militärs gehasste Zivilisten aus der äußersten Linken waren. Später wurde dies durch die Aussage eines zentralen Zeitzeugen, zu dem wir noch kommen, bestätigt. Auch der spätere Rechtsbeistand des Mörders von Rosa Luxemburg, Rechtsanwalt Otto Kranzbühler, war noch 1990 im Interview mit dem Autor der Überzeugung, dass bei dem Prozess „damals gemauert wurde.“
Die Angeklagten im Mordfall Liebknecht wurden am 14. Mai 1919 sämtlich freigesprochen, obwohl Ankläger Jorns, taktisch geschickt, die Todesstrafe für die Schützen gefordert hatte. Im Mordfall Luxemburg wurde Vogel ebenfalls freigesprochen, und zwar vom Mordversuch, aber wegen „Beiseiteschaffung einer Leiche“, er hatte Rosa Luxemburgs leblosen Körper in den Landwehrkanal werfen lassen, zu zwei Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt. Der Jäger Otto Runge, der Liebknecht mit einem und Rosa Luxemburg mit zwei Kolbenschlägen schwer verletzt hatte, erhielt wegen versuchtem Totschlag zwei Jahre Gefängnis. Runge musste als Einziger seine Strafe absitzen und 1945 70-jährig mit dem Tod für seine Tat bezahlen. Vogel wiederum, der als Todesschütze galt, wurde zwar in der Verhandlung noch als Mordverdächtiger gesehen, aber im Urteil nicht für den Mord belangt, da man jetzt erklärte, ein unbekannter Marineoffizier habe Rosa Luxemburg erschossen. Ironie der Geschichte: Es war tatsächlich ein Marineoffizier gewesen.
Runge aber erhielt seine Strafe nicht wegen Totschlags, da die Leiche Luxemburgs noch nicht gefunden worden war und somit nicht festgestellt werden konnte, ob der Schuss des unbekannten Marineoffiziers bzw. Vogels oder die Schläge Runges sie getötet hatten. Ankläger Jorns, der in seinem Plädoyer noch vom Schützen Vogel ausging, führte dazu einen interessanten Eiertanz auf: „Wir stehen also hier vor der eigentümlichen Sachlage, daß durch die Handlung eines der beiden Angeklagten [Vogel oder Runge, KG] zweifellos der Tod der Frau Rosa Luxemburg herbeigeführt worden ist, daß wir aber nicht sagen können, wer von den beiden dies ausgeführt hat. Bei Runge würde hier also nur Versuch vorliegen und man wird auch den Oberleutnant Vogel nur wegen Versuchs einer strafbaren Handlung verurteilen können, und zwar wegen Versuchs am untauglichen Objekt, wie der terminus technicum [sic!] hierfür lautet.“ (Wortprotokoll, S. 955)
Die Obduktion der Ende Mai – nach dem Prozess – gefundenen Leiche Luxemburgs ergab dann aber mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass der Schuss sie zum Tod befördert hatte und nicht die Schläge Runges. Da Vogel aber schon geflohen und in den Niederlanden war und der Marineoffizier noch nicht identifiziert werden konnte, gab es erstmal keine weitere Sühne. Gleichwohl forderte Runge eine Wiederaufnahme des Verfahrens. Die wurde ihm nicht gewährt. Die Begründung ist ebenfalls bemerkenswert: „Der Antragsteller [Runge, KG] stützt seinen Antrag auf die neue Behauptung, daß er die Straftaten auf Befehl von Vorgesetzten ausgeführt habe. Diese Behauptung ist indessen unerheblich, da, wenn er wirklich solche Befehle erhalten haben sollte, es sich nicht um rechtmäßige Befehle in Dienstsachen, zu deren Befolgung er verpflichtet gewesen wäre, gehandelt hatte, sondern um Befehle, die Verbrechen oder Vergehen bezweckten (Paragraph 47 des Militärstrafgesetzbuchs). Dafür, daß der Antragsteller das nicht erkannt haben sollte, fehlt es an jedem Anhalt.“ Eine bestechende Argumentation, die deutschen Gerichte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bezüglich der NS-Täter (Paragraph 47 galt auch in der NS-Zeit) leider nicht übernommen haben.
Die Freisprüche gegen die Liebknecht-Mörder Pflugk-Harttung et al. waren schon im Oktober 1919 von der Reichsregierung (auch Reichspräsident Friedrich Ebert hatte dem, entgegen der Behauptungen seines Biografen Walter Mühlhausen, zugestimmt) für rechtmäßig erklärt worden. Interessanterweise forderten jedoch zwei Gutachten, eines des Reichsjustizministers Eugen Schiffer und eines des Reichsmilitärgerichts (!), die Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Vogel, da man Näheres über den unbekannten Marineoffizier erfahren wollte. Vogel stand kurz vor der Auslieferung aus den Niederlanden und es war anzunehmen, dass er bei einer neuerlichen Verhandlung, seinem Wesen und Namen entsprechend, singen würde. Als Reichswehrminister Gustav Noske (SPD) plötzlich und unerwartet das Urteil gegen Vogel am 8. März 1920 betätigte (BA-SAPMO, AA, Vogel, Nr. 27402/1, Bl. 143). Später log er in seinen Memoiren, „die ersten Autoritäten der zivilen und Militär-Gerichtsbarkeit“ (Noske, Von Kiel bis Kapp, Berlin 1920, S. 76) hätten ihm dazu geraten.
Die Vorgeschichte
Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg waren unerschrockene und konsequente Kriegsgegner. Sie schlossen sich weder dem Kriegstaumel des 4. August 1914 an, noch wollten sie auf Klassenkampf im Krieg verzichten. Dafür wurden sie von der wilhelminischen Justiz zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt und von der SPD-Führung 1916 aus der Partei geworfen. Sie schlossen sich 1917 mit ihrer kleinen, aber tatkräftigen, teils sektiererischen Gruppe „Spartakus“ der Unabhängigen Sozialdemokratie (USPD) an und bildeten ihren linken Flügel. Die Oktoberrevolution 1917 inspirierte beide, die erst seit den Tagen des Weltkriegsbeginns eng zusammenarbeiteten, sie vertraten jetzt das Prinzip der Rätedemokratie und forderten nicht nur ein Ende des Krieges, sondern die sozialistische Revolution. Damit wurden sie zum Hassobjekt der Bürger, Kleinbürger und Militärs. Dass Rosa Luxemburg auch die Bolschewiki scharf kritisierte, war der Öffentlichkeit unbekannt, hätte vermutlich aber nichts daran geändert, dass beide ins Visier der Konterrevolution, der Militärs, speziell der Freikorps gerieten, die sich nach der Novemberrevolution von 1918 als extrem gewalttätige Truppen gebildet hatten, aber mit der SPD-Regierung ganz offiziell zusammenarbeiteten und auch ihr unterstanden. Schon Ende 1918 forderten Plakate der antibolschewistischen Liga (finanziert u. a. von dem Bankier Salomon Marx und dem Großindustriellen Hugo Stinnes) zum Mord an Liebknecht auf: „Tötet Liebknecht, schlagt ihre Führer tot.“
An Silvester 1918/19 gründeten Luxemburg und Liebknecht die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD), die Luxemburg gerne anders, nämlich Sozialistische Partei genannt hätte. Die Partei blieb kurz nach ihrer Gründung ohne großen Einfluss. Als jedoch der Berliner Polizeipräsident Eichhorn (USPD), eine der letzten Bastionen der Linken aus der Revolution, Anfang Januar 1919 abgesetzt wurde, kam es zu Massendemonstrationen, die die Radikalen in der USPD, aber auch Liebknecht zum Sturz der Regierung ausnützen wollten: der Januaraufstand (falsch als Spartakusaufstand bezeichnet) brach aus. Er misslang. Die Besetzer von Gebäuden und Zeitungsverlagen wurden mitten in Berlin mit Artillerie herausgeschossen, nicht wenige von ihnen auch nach den Kampfhandlungen ermordet. Luxemburg und Liebknecht missachteten alle Regeln der Konspiration, trennten sich weder noch flohen sie.
Die Tatnacht
Beide wurden am Abend des 15. Januar 1919 von der Wilmersdorfer Bürgerwehr, in der Mannheimer Straße 43 in Wilmersdorf, festgesetzt – die fünf Männer erhielten dafür zusammen 13.600 Mark (Bericht des Staatsanwalts Ortmann, 5.2. und 24.2.1919, in: BA-SAPMO, Nachlass Heine, Nr. 144, Bl. 4) – und schließlich zur Vorgesetzten Behörde, der Garde-Kavallerie-Schützen-Division (GKSD), die im Eden-Hotel residierte, verschleppt. Die wurde faktisch von einem kleinen Hauptmann in hochglanzgewichsten Stiefeln kommandiert: Waldemar Pabst. Es war das größte Freikorps, das über 30.000 Mann schwere Waffen und 70 Offiziere verfügte. Fast all diese Offiziere hatten nicht nur einen Hass auf die Novemberrevolution, sondern auch auf Liebknecht und Luxemburg, die als Anführer der Revolution, als Bolschewisten angesehen wurden. Ein Synonym in Deutschland dafür war Spartakisten. Pabst beschloss, wie er später zugab, die zwei Parteiführer „richten“ zu lassen (Interview Pabst, in: Der Spiegel, Nr. 16/1962). Angeblich hatte er wenige Wochen zuvor beide selbst sprechen hören und war sogar von einem seiner Offiziere gebeten worden, sie im Eden-Hotel auftreten zu lassen. Der Auftritt erfolgte nun unter anderen Vorzeichen. Pabst befahl eine Marine-Spezialeinheit ins Eden-Hotel, zu denen sein Freund Horst von Pflugk-Harttung, die erwähnten Marineoffiziere von Ritgen, Schulze, Stiege und der junge Marineleutnant Hermann Souchon gehörten. Sein Adjutant Hauptmann Heinz von Pflugk-Harttung, und ein Offizier namens Rühle von Lilienstern gehörten ebenfalls zur Verschwörertruppe. Sie alle stimmten Pabsts Mordabsicht (die sie nicht als solche sahen) zu und beschlossen Stillschweigen (Brief von Pflugk-Harttung an Pabst, vom 2.5.1962, in: Klaus Gietinger, Eine Leiche im Landwehrkanal, S. 134–136). Pflug-Harttung hatte die Aufgabe, Liebknecht beim vorgetäuschten Transport nach Moabit im Tiergarten auf der Flucht (zusammen mit den mitfahrenden anderen Offizieren) zu erschießen. Hermann Souchon wiederum sollte Rosa Luxemburg als Unbekannter aus der Menge beim Abtransport im Dunkel unweit des Eden-Hotels erschießen. (Gedächtnisprotokoll eines Gespräches mit Major a.D. Waldemar Pabst vom 7.12.1967 mit Dieter Ertel und Hans Beuthner SDR, in: Gietinger, Leiche, S. 144.)
Beide Morde wurden befehlsgemäß ausgeführt. Jedoch gab es mehrere Pannen: Der am Eingang des Eden-Hotels stehende Posten Runge war von einem Hauptmann namens Petri mit 100 Mark bestochen worden, er solle Liebknecht wie Luxemburg mit dem Gewehrkolben erschlagen. Petri wusste von den Beschlüssen im ersten Stock nichts, wie auch Pabst von der Eigenmächtigkeit Petris nichts wusste. Später will er Petri deswegen scharf zurechtgewiesen haben. Dass beide Sozialistenführer unmittelbar vor dem Hoteleingang „coram publico“, wie Pabst sich ausdrückte – schließlich war das Hotel auch mit Zivilisten belegt – angegriffen wurden, war in seinem Plan nicht vorgesehen. Er will seinen Mordplan auch Noske in jener Nacht per Telefon bekanntgegeben haben. Der soll ihm mitgeteilt haben, dass er den Tötungsbefehl nicht geben könne. Pabst solle den kommandierenden General anrufen. Der würde ihm den Befehl nie gegeben haben, erwiderte Pabst. Dann soll Noske gesagt haben: „Dann müsse er selbst verantworten, was zu tun sei.“ (Faksimile eines Briefes des Rechtsanwaltes Otto Kranzbühler vom 12.1.1993 an den Autor, in: Gietinger, Der Konterrevolutionär Waldemar Pabst – eine deutsche Karriere, Hamburg 2009, S. 397; Pabst hatte dies Kranzbühler im Dezember 1968 persönlich mitgeteilt)
Der Tag danach
Am 16. Januar 1919 stellte Fritz Grabowsky, Pabsts Propagandachef, die Tat so dar, als sei Liebknecht im Tiergarten auf der Flucht erschossen worden und Rosa Luxemburg dem schwerbewaffneten Transportfahrzeug durch eine aufgebrachte Menschenmenge (eine klassische Männerfantasie) entrissen worden.
Gleichwohl wurde Pabst am Morgen in die Reichskanzlei zitiert. Er brachte eine schwerbewaffnete Truppe mit, die ihn, sollte er verhaftet werden, herauszuschießen hätte. Doch nichts davon geschah. Die Regierung, (ausschließlich SPD-Mitglieder) darunter Noske und Ebert, drückte ihm die Hand. Schließlich wurde bestimmt, so bezeugte es auch Kriegsgerichtsrat Kurtzig später (Aussage Kurtzig im ersten Jorns-Prozess, nach Berliner Tageblatt vom 20.4.1929; siehe auch Paul Levi, Der Jorns-Prozess, Berlin 1929, S. 24; noch detaillierter ist Kurtzigs Aussage im zweiten Jorns-Prozess, siehe „Vorwärts“ vom 31.1.1930), dass das Kriegsgericht der GKSD den Fall zu übernehmen habe. Vergessen war die Abschaffung der Militärjustiz, die die SPD immer wieder gefordert hatte, vergessen war der Untersuchungsausschuss vom Dezember 1918, der die ersten Massaker an Zivilsten in der Novemberrevolution untersucht hatte, ja man war nicht einmal auf die Idee gekommen, ein Zivilgericht, bzw. die zivile Staatsanwaltschaft mit dem Fall zu betrauen. Und dies trotz zahlreichen Massenprotesten im ganzen Land, auch aus der SPD, aus dem Vollzugsrat von Groß-Berlin und dem rein aus SPD-Mitgliedern bestehenden Zentralrat. Kriegsgerichtsrat Kurtzig, machte sich – offensichtlich unvoreingenommen – an die Arbeit und ließ den Transportführer des Liebknecht-Transportes Kaleu Pflugk-Harttung und den Transportführer des Luxemburg-Transporte Kurt Vogel sofort verhaften. Das gefiel Pabst gar nicht und er setzte bei seinem Kommandeur, dem herzkranken General Hofmann, der eingeweiht war, durch, dass Kurtzig von eben jenem Jorns abgelöst wurde.
Voruntersuchung
Jorns vertuschte, wo es ging. Er ließ Vogel und Pflugk-Harttung sofort frei, quartierte sich im Eden-Hotel neben Pabst ein, konnte den flüchtigen Runge nicht finden, versäumte es, die Tat-Kfz untersuchen zu lassen und fand nichts dabei, alle Akten über den Tisch des der Beihilfe zum Mord verdächtigen Hauptmann Heinz von Pflugk-Harttung gehen zu lassen, der sie wiederum Pabst vorlegte. Wo es nicht zu vermeiden war, fälschte Jorns sogar das Verhör-Stenogramm in der Schreibmaschinenfassung. Als Runge schließlich von einer anderen Einheit aufgestöbert wurde und er Jorns gestand, Geld bekommen zu haben, beruhigte ihn der Ermittler: „Sehen Sie, Sie brauchen keine Angst zu haben“. Im Protokoll stand, Runge habe kein Geld bekommen. Die Untersuchung trat somit auf der Stelle.
10 Jahre später, 1928/29, strengte Jorns einen Prozess gegen die Zeitschrift „Das Tagebuch“ an, in dem ein Anonymus ihm deswegen Vertuschung vorgehalten hatte. (Vgl. Das Tagebuch, 9. Jg. 1. Halbjahr 1928, S. 471–473) Paul Levi vertrat den Herausgeber Josef Bornstein, bekam Akteneinsicht und konnte Jorns Vertuschung bzw., wie es juristisch exakt hieß, „Vorschubleistung“ nachweisen. Dem Staatsanwalt unterliefen mehrfach freudsche Versprecher, indem er den Nebenkläger Jorns als Angeklagten bezeichnete. Das Gericht schloss sich den Ausführungen Levis an, sah den Beweis für die Behauptung, Jorns habe als Untersuchungsrichter den Mördern Rosa Luxemburgs Vorschub geleistet, als erbracht. Jorns glaubte noch im Saal verhaftet zu werden. Prozess und Urteil erregten großes Aufsehen in der Öffentlichkeit. Jorns aber ließ dagegen Berufung einlegen. Der Beleidigungsprozess ging am 27. Januar 1930 vor der dritten großen Strafkammer des Landgerichts I in die zweite Runde. Wieder übernahm Levi die Verteidigung, erkrankte aber sehr bald und stürzte sich im Fieberrausch aus dem Fenster. Bornstein verteidigte sich fortan selbst. Die Staatsanwaltschaft, die sich der Berufung Jorns‘ nicht angeschlossen hatte, beantragte Freispruch für Bornstein. Jorns beleidigte daraufhin seinen Kollegen. So ergab sich, dass es zwischen dem Nebenkläger Jorns und dem Hauptkläger, dem Oberstaatsanwalt, zu heftigen Auseinandersetzungen kam. Dies gipfelte im Ausspruch des letzteren, Jorns habe es aus politischen Motiven heraus gewagt, die Ehre der Justiz zu vernichten. Das Gericht entschied auch hier, daß der Beweis für die Vorschubleistung von Jorns erbracht sei. Jorns wurde ein zweites Mal blamiert. Doch dieser wandte sich nun an den höchstinstanzlichen Vertreter der Gerechtigkeit: das Reichsgericht in Leipzig. Dieses erlauchte Gremium gab sich viel Mühe und fand zu dem Rechtsgrundsatz, dass der Nachweis bewussten Vorschubleistens noch nicht ausreicht, um einem Untersuchungsbeamten zu beweisen, dass er Vorschub geleistet habe! Mit diesem Rechtsgrundsatz versehen, musste erneut vor einem Landgericht in Berlin verhandelt werden. Dieses verbog nun die Wahrheit und kam zu einem – erneut bemerkenswerten – Schluss: Die objektive Mangelhaftigkeit der Amtsführung von Jorns zu verbergen, wollte auch der 4. Großen Strafkammer nicht gelingen. Aber es stellte fest, daß sich Jorns „subjektiv tadelfrei“ verhalten habe! Somit war Jorns rechtlich von jeder Schuld befreit.
Der weitere Untersuchungsweg
In der Öffentlichkeit ließ auch im Februar 1919 der Protest gegen das Verfahren nicht nach. Da schlug General Hofmann vor, aus dem Vollzugs- und dem Zentralrat Beisitzer zum Verfahren hinzuzuziehen. Oskar Rusch (SPD), Paul Wegmann (USPD), Hugo Struve (SPD) und Hermann Wäger (SPD) sollten nun mituntersuchen. Doch Jorns ließ sie ins Leere laufen. Sie durfte den Zeugen zunächst keine Fragen stellen, dann nach einem umständlichen Prozedere. Vorgeschlagene Verhöre wichtiger Zeugen erfolgten nicht, Pabst durften sie nicht befragen, da der erst „krank“ und kurz danach die Absperrungen bei Liebknechts Begräbnis befehligte. Jorns Verhöre erregten ihr Misstrauen. Schließlich warfen Rusch (SPD), Struve (SPD) und Wegmann (USPD) wütend das Handtuch und veröffentlichten eine Protestresolution. (Text in: „Die Freiheit“, vom 16.2.1919) Nur Wäger (SPD) blieb, sodass 1970/71 sowohl das Landgericht als auch das Oberlandesgericht in Stuttgart dies als Beweis ansahen, dass das Verfahren 1919 ordentlich geführt worden sei (Urteil des LG Stuttgart vom 12.2.1970, S. 33; Urteil des OLG Stuttgart vom 20.1.1971, S. 77, in: Archiv des SWR, Dokumentation der Vor- und Nachgeschichte des Verfahrens Souchon gegen SDR/Bausch/Ertel, S. 977, 1408). Eben jenes Verfahren wäre aber im Sande verlaufen, hätte nicht Leo Jogiches – langjähriger Lebensgefährte Rosa Luxemburgs und zu der Zeit Vorsitzender der KPD, als Nachfolger der beiden Ermordeten – durch eigene Recherchen und Zeugenbefragungen in der Roten Fahne einen Artikel veröffentlichen lassen, der Ross und Reiter nannte: Horst von Pflugk-Harttung als Liebknechtmörder, Vogel als Luxemburg-Mörder und Pabst als Drahtzieher im Hintergrund. („Rote Fahne“ vom 13.1.1919) Zwar hatte Jogiches dadurch sein Todesurteil unterschrieben. Er wurde wenige Tage später verhaftet und in Moabit mit Genickschuss umgebracht, doch jetzt musste etwas geschehen. Als Jorns dem Justizminister Otto Landsberg (SPD), hinter der Bühne des Nationaltheaters in Weimar, seine dürftigen Ermittlungsergebnisse vortrug, wurde der – öffentlich unter Druck geraten – rot und wütend (Aussage Landsbergs, in erstem Jorns-Prozess, nach Berliner Tageblatt, 18.4.1929). Jorns, der Landsberg wichtige Details verheimlicht hatte, (Siehe den Wortwechsel Levi/Landsberg/Jorns im ersten Jorns-Prozess, nach Berliner Tageblatt vom 18.4.1929) musste versprechen, Kaleu Pflugk-Harttung und die am Liebknecht Transport beteiligten Offiziere zu verhaften. Er tat dies aber erst am 28. Februar 1919, einen Tag nach Pabsts Hochzeit, bei der die Mord-Offiziere mittafelten und Noske Pabst ein Glückwunschtelegramm zukommen ließ. Gleichzeit meldete sich, aufgeschreckt durch den Artikel in der Roten Fahne, ein Stadtrat namens Grützner, der am 16. Januar die Wache im Eden-Hotel übernommen hatte. Ein Leutnant hatte ihm, mit Berufung auf Pabst, gebeten, er solle auf seine Mannschaft einwirken, dass sie „über den Vorfall mit Rosa Luxemburg günstig aussage.“ (BA-MA, PH 8‑V/Bd. 1, Bl. 40–44) Eine erste Spur zu Pabst.
Aufgrund von alldem und obwohl die Reichsregierung und der preußische Justizminister Wolfgang Heine (SPD) in der Öffentlichkeit weiter mauerten, und von einem unabhängigen Verfahren sprachen, war nun ein Prozess nicht zu vermeiden.
Im Untersuchungsgefängnis Moabit standen für die gefangenen Offiziere die Zellentüren immer offen, außerdem verfügten sie über Waffen, und wie Runge später bekundete, drohten sie, ihm eine Handgranate unter die Pritsche zu legen, sollte er nicht günstig für sie aussagen. Sie probten in der Untersuchungshaft sogar Runges Auftritt vor Gericht, und er bekam 1920 für seine im Prozess die Offiziere begünstigenden Aussagen von Rechtsanwalt Grünspach 3000 Mark Bestechungsgeld. Richter Canaris besuchte zudem als Richter die Offiziere in Moabit, um, wie er sich entschuldigte, mit ihnen über die Einwohnerwehren zu sprechen. (BA-MA, PH 8‑V/Bd. 4, Bl. 117; Telefonnotiz Korvettenkapitän Fliess vom 31.1.1931, in: BA-MA, RM 6/267, Handakte Canaris, Bl. 38) Canaris selbst war später auch dabei, als der Schwester der Brüder Pflugk-Harttung 30 000 Mark für deren Flucht übergeben wurde (Aussage des Vorsitzenden des Nationalverbands der Offiziere Brederick im dritten Jorns-Prozess, nach „Vorwärts“ vom 23.1.1931; siehe dazu auch die Auskünfte von Canaris, in: BA-MA, RM 6/267, Handakte Canaris, Bl. 50f. A.a.O. Bl. 22). Und nach dem Prozess sorgte er, getarnt als Leutnant Lindemann, mit einem gefälschten Befehl von Kriegsgerichtsrat Jorns dafür, dass Vogel aus dem Gefängnis Moabit freikam. Er ließ ihn per Flugzeug in die Niederlande transportieren, von wo aus der Pabst erpresste, er würde singen, sollte er nicht mit Geld versorgt werden, was auch geschah.
Der Prozess
Am 8. Mai 1919 begann der Prozess. Starke Einheiten der GKSD hatten das Kriminalgericht in Moabit abgeriegelt, für Einlasskarten waren hohe Schwarzmarktpreise geboten worden. (Original Einlasskarte, in: BA-SAPMO, NL 1/18, Bl. 2) Das ansonsten nicht übliche Wortprotokoll ist erhalten, wie die gesamten Akten der Voruntersuchung aus denen Levi die Vertuschung durch Jorns gerichtsglaubhaft herausarbeiten konnte. (Wortprotokoll, BA – MA, PH 8‑V/Bd. 5, 12 – 17; Voruntersuchung und Nachtragsbände, BA – MA, PH 8‑V/Bd. 6 – 11, 14, 19 – 22, 23.)
Die Angeklagten betraten an jedem der sieben Prozesstage durch dieselbe Tür wie die Richter den Saal, dessen Kopfende noch immer ein riesiges Bildnis Kaiser Wilhelms II. zierte. Während der gesamten Prozessdauer waren sie guter Dinge. Sie unterhielten sich sogar in den Verhandlungspausen mit ihren Verwandten im Zuschauerraum (Was der Vorsitzende Ehrhardt bestätigte, BA-MA, PH 8‑V/Bd. 13, S. 180.).
Verteidiger Grünspach vertrat später auch den wegen des Kapp-Putsches 1920 nach Österreich geflüchteten Pabst, ja sogar Ende 1919 den 30-fachen Matrosenmörder Otto Marloh (einen späteren Nazi) erfolgreich. Grünspach hatte aber auch keine Probleme linke Künstler wie George Grosz zu verteidigen. In den Sechziger Jahren gab Pabst einem ehemaligen SS-Offizier namens Cerff ein Tonbandinterview und meinte zu ihm: „Das wird Ihnen nicht gefallen, der Verteidiger war ein Jud!“
Der Prozess zeichnete sich dadurch aus, dass so gut wie alle Uniformierten Lügen auftischten, „dass sich die Balken bogen“ (Ausdruck von Paul Levi, den Günther Nollau in seiner Zeugenaussage vor dem LG Stuttgart 1970 wieder aufgriff. Levi, Jorns-Prozeß, S. 45, Protokoll der Aussage Nollaus vor dem LG Stuttgart am 12.12.1969, in: Dokumentation SDR, S. 844). Demgegenüber stand das stark eingeschüchterte Personal des Eden-Hotels, wovon Einzelne trotzdem, so das Stubenmädchen Anna Belger und die beiden 17 Jahre alten Kellner Mistelski und Krupp, den Mut aufbrachten, das zu berichten, was sie gesehen hatten und auch darauf zu beharren.
Das Stubenmädchen Anna Belger hatte gehört, wie Offiziere von einer „Begrüßung“ Liebknechts im Tiergarten gesprochen hatten. Die Kellner identifizierten den Anstifter der Kolbenschläge Runges als Hauptmann Petri, der nicht einmal als Zeuge, geschweige denn als Angeklagter, geladen war. Nach der Aussage des ehemaligen Beisitzers Wegmann (USPD), der sich ebenfalls traute auszusagen und vor Gericht als „Dissident“ bezeichnet wurde, herrschte unter dem Hotelpersonal erhebliche Angst. Sie hätten gesagt, dass sie sich vor der „Korona da unten fürchteten“. Wegmann erinnerte in diesem Zusammenhang auch an die Fememorde.
Wie gesagt, der Freund Pabsts und des Angeklagten Kaleu von Pflugk-Harttung, Canaris, war zum Richter bestimmt worden.
Pabst gab später zu: Die Fäden im Prozess, der eine ziemlich armselige Sache gewesen sei, irgendwie unter seinem „Niveau“, habe Canaris im Einvernehmen mit ihm und Jorns gezogen. Der Vorsitzende Ehrhardt, „ein etwas zu weicher Mensch“ (Dokument II in: Gietinger, Leiche, S. 139, zu Canaris/Jorns, S. 138), war wohl nicht bis ins Letzte eingeweiht worden, mauerte aber kräftig mit, um jeden Verdacht von seiner Division abzuweisen. Deshalb wurde die völlig unglaubwürdige Story der Gebrüder von Pflugk-Harttung und der Marine-Eskadron von der Panne im Tiergarten, dem Fluchtversuch des schwerverletzten Liebknecht, der so dumm gewesen sein sollte, mit blutendem Schädel vor ihnen davonzulaufen, für bare Münze genommen. Allerdings die leichte Verletzung, die sich Pflugk-Harttung an seiner Hand mit dem Hirschhorn-Taschenmesser Liebknechts eingeritzt hatte, wurde selbst von diesem Gericht nicht ernstgenommen.
Hätte ein anderer junger Marineoffizier, Ernst von Weizsäcker mit Namen, später Unterstützer des Holocaust im Außenministerium des deutschen Faschismus, der Wahrheit die Ehre gegeben, er hätte dem Gericht mitteilen müssen, was er seinem Tagebuch am 16. Januar 1919 anvertraute: „Kapitänleutnant von Pflugk-Harttung war heute im Mar.[ine KG] Kabinett [jetzt Personalamt] und erzählte gegen die Verpflichtung absoluter Geheimhaltung, daß er bei der Überführung Liebknechts in das Gefängnis eine Autopanne im Tiergarten fingierte, Liebknecht dann am Arm nahm, um ihn zu führen, ihn absichtlich losließ, um ihm die Gelegenheit zu einem Fluchtversuch zu geben und dann nach kurzem Abwenden hinter L. herschoß; Liebknecht wurde getroffen und von mehreren Schüssen getötet. Ich rate Pflugk zur Flucht.“ (Tagebucheintragung Ernst von Weizsäcker, in: Leonidas Hill (Hrsg.), Die Weizsäcker-Papiere 1900–1932, Berlin 1982, S. 325.)
Der Mord an Liebknecht wäre, zumindest was seine Ausführung betrifft, aufgeklärt gewesen. Im Fall Luxemburg sorgten dagegen die Aussagen der uniformierten Zeugen für große Verwirrung. (Wortprotokoll, BA-MA, PH 8‑V/Bd. 14, S. 571–598, Bd. 15, S. 609–703, 730–759)
Die Begleitmannschaften Weber und Grantke sagten aus, Vogel habe auf dem Trittbrett gestanden und habe Rosa Luxemburg erschossen. Der Jäger Poppe, der auf dem Trittbrett mitgefahren war, wollte sich nicht genau festlegen, glaubte aber, Vogel im Innern des Wagens gesehen zu haben. Der Fahrer Janschkow und sein Beifahrer Hall, die Vogel von der Bürgerwehr her kannten, behaupteten jedoch, Vogel habe auf der Rückenlehne des Vordersitzes gestanden, sich auf sie beide gestützt und mit ihnen gesprochen, während der Schuss gefallen sei. Hinzu kommt etwas sehr Seltsames. Sowohl die Begleitmannschaften als auch Vogel sprachen von einer unbekannten Person, dem ominösen Marineoffizier in Mannschaftsuniform, der mit dabei gewesen sein sollte und den aufzufinden sich Jorns außerstande gesehen hatte, obwohl Janschkow ihn am Tag nach dem Mord im Eden-Hotel wiedergetroffen hatte und ihm noch ein zweites Mal auf der Elektrischen begegnet sein wollte. Vogel hatte zur Identität desselben die Aussage verweigert. (Ebd., S. 743f., Aussage Janschkow, S. 657, Aussage Vogel) Trotz der intensiven Kontakte von Jorns zu Pabst ließ sich der Marineoffizier nicht finden. Nichtsdestoweniger ging Jorns davon aus, dass Vogel geschossen hatte, wollte ihn aber nicht des Mordes an Luxemburg überführt haben, weil ja nicht klar sei, ob nicht Runges Schläge den Tod herbeigeführt hätten.
Somit gab es zwar eine tote Rosa Luxemburg, die noch irgendwo im Landwehrkanal trieb, aber es gab keinen Mörder, sondern nur zwei, die einen Mordversuch begangen hatten. Und das Kameradengericht war hier noch weitaus „radikaler“. Es sprach Vogel auch vom Mordversuch frei, da es annahm, der unbekannte Marineoffizier, der „siebte Mann“ im oder am Wagen, habe die Schüsse abgegeben. (Urteil BA-MA, PH 8‑V/Bd. 17, S. 1036ff.) Dadurch konnte man im Fall Luxemburg harmlose Urteile austeilen. Und die Liebknechtmörder wurden einfach von ihren Kameraden-Richtern freigesprochen. Tatsächlich wussten alle verantwortlichen Beteiligten, wer der unbekannte Marineoffizier war: Hermann Souchon. Der wurde sogar bei der Justiz-Komödie als Zeuge vernommen und so zum Gericht zitiert, dass er den begleitenden Mannschaften des Luxemburgtransportes nicht über den Weg lief, denn die (obwohl auch von den Offizieren unter Druck gesetzt) hätten ihn als Mitfahrer und Schütze identifizieren können. 14 Tage nach Prozess-Ende stand in der Zeitung der USPD, „Die Freiheit“, wer da kurz auf dem Trittbrett mitgefahren war: Souchon (Die Freiheit vom 28.5.1919). Doch das interessierte weder die Regierung noch die zivile Justitia. Und die Militärjustiz dementierte. Erst 1959 offerierte Pabst dem damals stellvertretenden Verfassungsschützer der BRD, Günter Nollau (SPD), dass Souchon sich für die Tat freiwillig gemeldet und auch geschossen habe. Nollau behielt dies für sich, machte eine Aktennotiz, veröffentlichte aber eine andere für ihn wichtigere Aussage Pabsts: Wilhelm Pieck (KPD) – von 1949–1960 Präsident der DDR -, der mit Liebknecht und Luxemburg im Eden-Hotel festgesetzt worden war, habe Einzelheiten über Spartakus verraten (Persönliche Auskunft von Günther Nollau am 13.12.1989). Welche, gab Pabst nicht an. Vermutlich hatte Pieck in Todesangst aber nur irgendwelche Geschichten beim Verhör durch Pabst erzählt und war dann für unwichtig befunden und freigelassen worden (übrigens hatte Runge ihn bewacht). Später gab Pieck, gegen den ein Verfahren der KPD gelaufen sein soll, an, er habe beim Transport ins Gefängnis durch einen Sympathisanten bei den Bewachern entfliehen können. Eine wenig glaubwürdige Geschichte.
Erwähnenswert ist auch die Verteidiger-Strategie Grünspachs. Er benutzte den als unschuldig geltenden jungen Marineoffizier Souchon als „Kronzeugen“ der Verteidigung. Souchon hatte ausgesagt – das wiederholte er sogar 50 Jahre später in einer eidesstattlichen Versicherung – dass er mit seinen Kameraden ins Eden-Hotel kommandiert worden sei und auf der Treppe vor Pabst Raum ahnungslos mit ihnen gewartet habe. Nur Kapitänleutnant Pflugk-Harttung sei zu Pabst hineingegangen. Grünspachs Folgerung: Also hätten sich die Offiziere gar nicht untereinander und mit Pabst absprechen können. Das Gericht fiel schließlich gern auf diesem geschickten Trick herein. Dass Souchon der Mörder Luxemburgs war und die Offiziere sich alle untereinander bei Pabst drin abgesprochen hatten, ging erst Jahrzehnte später aus Aussagen Pabsts, Pflugk-Harttungs, und Stieges hervor. (Das Plädoyer Grünspachs in: BA-MA PH 8‑V/17, S. 988 – 1028)
Übrigens wurde in einem fast parallelen Prozess vom 19. Mai bis zum 23. Juni 1919 gegen den USPD-Abgeordneten Georg Ledebour wegen Hochverrates verhandelt. Ledebour hatte sich wie Liebknecht führend am Januaraufstand beteiligt. Auch von diesem Prozess gibt es ein Wortprotokoll. Und kaum zu glauben, Ledebour wurde freigesprochen, obwohl der Staatsanwalt namens Zumbroich ein Rechtsaußen war, der im März 1920 beim gescheiterten präfaschistischen Kapp-Putsch – an dem sich Pabst ebenfalls führend beteiligte – kurzzeitig als Putsch-Justizminister fungierte.
Der Ausgang des Ledebour-Prozesses belegt, dass sowohl Liebknecht und insbesondere Rosa Luxemburg, wären sie wegen Hochverrates angeklagt worden, ebenfalls freigesprochen worden wären. Das Gericht sah erstaunlicherweise den Januaraufstand als einen Aufstand in einem revolutionären Prozess und nicht als Hochverrat an.
So sind etwa Behauptungen von SPD-Genossen wie Tilman Fichter (1995) und Hans Ulrich Wehler (1999), Luxemburg hätten wegen Hochverrates und Bürgerkriegsauslösung standrechtlich erschossen werden können, völlig unzutreffend. Weder war der Belagerungszustand (Ausnahmezustand) im Januar 1919 ausgerufen worden noch ließ das preußische Belagerungsrecht Standgerichte am selben Tag und ohne oberste Absegnung zu.
Das hinderte den ehemaligen NS-Propagandafilm-Drehbuchschreiber Albrecht Freiherr von Wechmar (CDU) nicht, im Jahr 1967, als Regierungssprecher und Freund Pabsts, die Ermordung von Luxemburg und Liebknecht als standrechtliche Erschießung umzudeuten. (Verlautbarung des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung vom 8.2.1962)
Doch was geschah nach dem Prozess? Am besten kann das anhand des Schicksals der Mordbeteiligten und ihrer Unterstützer erzählt werden.
Pabst sagte auch vor Gericht aus, wurde trotz aller Verdächtigungen und Indizien weder in Weimar verfolgt noch nachdem er die Mordbefehle im Nachkriegs-Westdeutschland zugegeben hatte. 1920 hatte er sich führend am Kapp-Putsch beteiligt, war nach Österreich geflohen, war da ebenfalls führend beim Aufbau der profaschistischen Heimatwehr beteiligt und wurde vom deutschen Außenminister Gustav Stresemann als Agent mit hohem Salär beschäftigt. 1931 lehnte es Pabst ab, für Hitler den Posten des „politischen Organisationschef(s)“ zu übernehmen, wirkte als Wehrwirtschaftsführer im NS-Staat und wurde Direktor im Rüstungskonzern Rheinmetall-Borsig. Dann verdiente er sich eine goldene Nase im Rüstungsgeschäft mit der Schweiz. Die gewährte ihm Asyl, lieferte ihn auch nach dem Zeiten Weltkrieg nicht an Frankreich aus und ab 1955 kehrte Pabst in die BRD zurück, wirkte weiter als Rüstungsprofiteur und gab 1962 dem Spiegel ein Interview, in dem er sich dazu bekannte, Rosa Luxemburg „gerichtet“ zu haben. Er starb 1970 in hohem Alter, ohne je wegen seiner Taten belangt worden zu sein.
Horst von Pflugk-Harttung betätigte sich in Skandinavien als Waffenbeschaffer und Geheimagent von Canaris. Er wurde mehrfach ausgewiesen und schloss sich schließlich der NSDAP an. Nach dem Krieg lebte er als Kaufmann in Hamburg und nahm wieder Kontakt zu Pabst auf.
Sein Bruder Heinz, der Hauptmann, beteiligte sich am Kapp-Putsch, sprengte sich aber aus Versehen mittels zu vieler Handgranaten in seinem Auto selbst in die Luft. Stiege versuchte seine Karriere in der Marine fortzusetzen, wurde aber kurz nach dem Krieg, da galt der Mord an Liebknecht und Luxemburg noch als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, vor den Entnazifizierungsausschuss zur Tat vernommen. Er leugnete seine Mord-Beteiligung. Der Ausschuss ließ die Vertuschungsakten und das Prozessprotokoll von 1919 kommen und entschied, dass keine Schuld auf dem Mann laste. (Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Spruchkammerakten Heinrich Stiege, Abt. 520 F/A 409–499) Kurz vor seinem Tod im Jahr 1967 bekam Stiege noch Besuch von dem Dokumentarfilmer Dieter Ertel, der den Auftrag hatte, zum 50. Todestag ein Fernsehspiel für den SDR zu schreiben. Ertel las ihm seine Aussage vor Gericht zum Liebknecht-Mord vor: „Wohin haben sie gezielt? Auf das Kreuz, Wenn man davon reden kann.“ Nach Auskunft von Ertel soll er 1967 danach „leicht grün“ angelaufen sein. Mehr passierte ihm nicht. Rudolf Liepmann schrieb noch eine Doktorarbeit über den Waffengebrauch gegen Fliehende, war aber ab 1933 als Jude der NS-Verfolgung ausgesetzt. Ihm gelang 1938 noch die Auswanderung nach Shanghai, wo sich seine Spur verliert.
Ebenfalls Jude, wurde Pabsts Propagandachef Grabowsky, der im Eden-Hotel aus „Rücksicht“ auf die antisemitischen Offiziere keine Uniform getragen hatte, obwohl er sich am Kapp-Putsch beteiligt hatte, von den Nazis 1938 ins KZ gesteckt. Canaris holte ihn heraus und setzte ihn im besetzten Frankreich als Spion ein. In Paris residierte er dazu in der Wehrmachtszentrale im Hotel Majestic. Den Krieg überlebte er trotz Canaris’ Sturz und nahm in der BRD, in Aachen lebend, wieder Kontakt zu Pabst auf.
Vogel kehrte, von Pabst weiter versorgt, zur NS-Zeit nach Deutschland zurück und brüstete sich nun, Luxemburg und Liebknecht beseitigt zu haben. Seine Spur verliert sich im Westberlin der 50er Jahre.
Hermann Souchon floh nach Finnland, trat der faschistischen Lappo-Bewegung bei und bot sich Pabst als Kontaktmann einer von diesem geplanten Weißen Internationale an. 1925 kurzzeitig in Deutschland, wurde er nochmals von der Staatsanwaltschaft verhört, die ihn nun doch, nach einer Aussage des Fahrers Janschkow, verhören musste. Er gab die Beteiligung am Luxemburg-Transport zu, leugnete aber, geschossen zu haben. Die Staatsanwaltschaft verzichtete, ihn wegen Meineids zu verfolgen, denn 1919, bei seiner Aussage vor dem Kameradengericht, hatte er die Beteiligung verschwiegen. Souchon durfte wieder nach Finnland abdampfen (Landesarchiv Berlin, Rep. 58, Nr. 464, Bl. 2ff. und Bd. I, Bl. 4550). In der NS-Zeit machte er dann Karriere als Oberst der Luftwaffe und lebte nach dem Krieg in Bonn. Runge aber wurde nach der Kapitulation 1945 von deutschen Kommunisten in Berlin festgesetzt und dort dem NKWD (Prenzlauer Allee 173) übergeben. Wo er nach einem Verhör, vermutlich an den Folgen von Folterungen, starb.
Es gab viele Versuche, die Verschwörung gegen Liebknecht und Luxemburg und die von der Reichsregierung geduldete, ja geförderte Vertuschung durch die Justiz aufzuklären. Paul Levi und die USPD brachten nach Jogiches erstes Licht ins Dunkel, so auch die Nachforschungen der KPD 1928. Aber erst 1967 gelang es Heinrich Hannover und seiner Frau Elisabeth Hannover-Drück, Akten in Potsdam zu sichten und daraus einen kleinen Bestseller zu machen, der die Mordsache weiter erhellte (Heinrich Hannover, Elisabeth Hannover-Drück: Der Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Dokumentation eines politischen Verbrechens, Frankfurt 1967.). Dieter Ertel, der zur gleichen Zeit recherchierte, gelang es unter Zeugen, Pabst zu befragen und er gab erneut seine Mordbefehle und die Täterschaft Souchons zu. Ertel ließ dies in einer Pressekonferenz verkünden. Pabst gratulierte. Pflugk-Harttung meldete sich jetzt aber bei Pabst und warf ihm vor, das Schweigegelübte gebrochen zu haben. Noch viel schärfer reagierte Souchon. Als Ertel ihn nach den Pabst-Aussagen anrief und ihm Pabsts Aussage, wer den tödlichen Schuss auf Luxemburg abgegeben habe, übermittelte, sagte Souchon: „Das können Sie gar nicht wissen“ (Persönliche Auskunft von Dieter Ertel 1989). Er erhob Klage gegen den SDR, Ertel und den Intendanten des SDR, Hans Bausch (CDU). Doch das zweiteilige Fernsehspiel, geschrieben von Ertel und inszeniert von Theo Mezger, konnte mit einem relativierenden Vorspruch gesendet werden. Danach gab es zwei Gerichtsverhandlungen.
Eine vor dem Landgericht Stuttgart, wo Souchon unter Eid aussagte, nicht geschossen zu haben. Pabst jedoch ließ sich verhandlungsunfähig schreiben und drückte sich vor einer Aussage. Gegenüber dem Anwalt von Souchon, Otto Kranzbühler, ruderte er zurück und ließ sich – da er erkannte, dass Souchon sich nicht wie er zur Tat bekennen wollte – zu einer eidesstattlichen Aussage drängen, er habe Ertel nie gesagt, dass Souchon geschossen habe. Was nachweislich falsch war, denn es gab mehrere Briefe Pabsts sowie die Aussage von Nollau. Später hat der Autor im Nachlass Pabsts noch weitere Briefe unter anderem an seinen Anwalt gefunden, in denen er klar aussagte, er habe Souchon damals den Befehl gegeben und der habe auch geschossen.
Souchon aber war durch den Teilrückzieher fein heraus und das Gericht erklärte nun, Pabst sei von Zerebralsklerose (Gedächtnisschwund, schon seit 1959?) befallen, nahm sich die Akten des Kameradengerichts vor und sah sie als bare Münze an. Pabst aber gab in einem internen Schreiben die Deckung seiner Tat durch Noske zu (Abschrift eines Pabst-Briefes vom 26.6.1969, BA-MA, Nachlass Pabst, N 620/21). Ertel und der SDR wurden verurteilt und mussten in der Tagessschau (!) die Aussage zurücknehmen, Souchon habe geschossen. Das Fernsehspiel kam in den Giftschrank. Es ist offiziell immer noch verboten, wurde aber schon mehrfach gesendet und ist inzwischen auch als DVD erhältlich.
Bei jener Begegnung mit dem Marinerichter Kranzbühler 1968, sagte Pabst diesem auch „unter uns“, dass Noske seine Tat in der Mordnacht abgesegnet habe. 1990 bei einem Interview wollte Kranzbühler das Martin Choroba und dem Autor gegenüber noch nicht zugeben, denn, so er selbst damals: Pabst Aussage sei so ungeheuerlich, dass er das nicht weitergeben wollte. Da der Autor aber in einem historischen Aufsatz zu sehr das Offizierskomplott betonte, schrieb Kranzbühler einen Brief und gab die Noske-Aussage Pabsts zum Besten. Nur so erklärt sich auch Noskes Absegnen des Vogel-Urteils gegen jeden juristischen Rat. Noske, der nach dem Kapp-Putsch als Reichswehrminister zurücktreten musste, wurde 1933 von Adolf Hitler im Sportpalast sogar als „Eiche unter diesen sozialdemokratischen Pflanzen“ (Hitler in seiner Sportpalastrede am 2. März 1933, laut Völkischer Beobachter vom 3.3.1933, zitiert nach Wolfram Wette, Gustav Noske – Eine politische Biographie, Düsseldorf 1987, S. 756) bezeichnet. Er bekam seine Pension weiter und musste nicht emigrieren. Selbst als er sich auf einer Liste der Offiziere des 20. Juli als Mann fand, der zum Durchgreifen bereit war, sperrten ihn die Nazis nur ein und verzichteten, ihn, wie die anderen Widerständler, an einen der Fleischerhaken in Plötzensee zu hängen. Noske überlebte und starb verbittert kurz nach dem Krieg.
Zusammengefasst: Der Prozess 1919 konnte nur durch den Schutz Noskes und der SPD-dominierten Regierung als eine solche Schmierenkomödie stattfinden. Die Aufklärung des Verbrechens ließ nur deswegen Jahrzehnte auf sich warten. Generalmajor von Thaer von der Obersten Heeresleitung (OHL) vertraute schon Ende 1918, als Luxemburg und Liebknecht noch lebten, seinem Tagebuch an: „Ebert und Scheidemann zittern vor Liebknecht und Rosa und wünschen ihr Verschwinden auf kriminelle Art, nur: Sie wollen nichts davon wissen, nichts damit zu tun haben.“ (Albrecht von Thaer, Generalstabsdienst an der Front in der OHL. Aus Briefen und Tagebuchaufzeichnungen. 1915–1919, S. 280f.)
Literaturverzeichnis
Bundesarchiv Militärarchiv (BA-MA): Urteil, PH 8‑V/Bd. 17, S. 1036ff; PH 8‑V/Bd. 1, Bl. 40–44; PH 8‑V/Bd. 4, Bl. 117.
Wortprotokoll der Hauptverhandlung, BA-MA PH 8‑V/Bd. 12, Bl. 19–21, Online einsehbar; PH 8‑V/Bd. 17, S. 955; BA-MA, PH 8‑V/Bd. 14, S. 571–598, Bd. 15, S. 609–703, 730–759; BA – MA, PH 8 V/Bd. 5, 12–17.
Voruntersuchung und Nachtragsbände, BA – MA, PH 8 V/Bd. 6–11, 14, 19–22, 23.
Abschrift eines Pabst-Briefes vom 26.6.1969, BA-MA, Nachlass Pabst, N 620/21.
(Alle oben genannten Akten, auch das Wortprotokoll der Hauptverhandlung vom Mai 1919 und wichtige Teile des Nachlasses Pabst sind inzwischen online beim Bundesarchiv abruf- und kopierbar. Anmeldung genügt: https://invenio.bundesarchiv.de/invenio/login.xhtml )
Telefonnotiz Korvettenkapitän Fliess vom 31.1.1931, in: BA-MA, RM 6/267, Handakte Canaris, Bl. 38, Bl. 50f. A.a.O. Bl. 22.
Urteil des Landgerichts (LG) Stuttgart vom 12.2.1970, S. 33, Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Stuttgart vom 20.1.1971, S. 77, in: Archiv des SWR, Dokumentation der Vor- und Nachgeschichte des Verfahrens Souchon gegen SDR/Bausch/Ertel (1966–1975, Dokumentation SDR), S. 977, S. 844 u. S. 1408.
Albrecht von Thaer, Generalstabsdienst an der Front in der OHL. Aus Briefen und Tagebuchaufzeichnungen. 1915–1919, hrsg. von Siegfried A. Kaehler, Göttingen 1958, S. 280f.
Bericht des Staatsanwalts Ortmann an den Preußischen Justizminister Wolfgang Heine (SPD) vom 5.2. und 24.2.1919. BA-SAPMO, Nachlass Heine, Nr. 144, Bl. 4.
Bundesarchiv Berlin, SAPMO (BA-SAPMO), Auswärtiges Amt (AA), Vogel, Nr. 27402/1, Bl. 143; Original Einlasskarte, in: BA-SAPMO, NL 1/18, Bl. 2.
Das Tagebuch, 9. Jg., 1. Halbjahr 1928, S. 471–473, Autor: Berthold Jacob Salomon (1898–1944).
Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Spruchkammerakten Heinrich Stiege, Abt. 520 F/A 409–499.
Landesarchiv Berlin (LAB), Rep. 58, Nr. 464, Halbakte, Bl. 2ff. und Bd. I, Bl. 4550.
Levi, Paul: Der Jorns-Prozess, Berlin 1929.
Gietinger, Klaus: Eine Leiche im Landwehrkanal – Die Ermordung der Rosa L., Berlin 1995.
Gietinger, Klaus: Der Konterrevolutionär Waldemar Pabst – eine deutsche Karriere, Hamburg 2009.
Noske, Gustav: Von Kiel bis Kapp, Berlin 1920, S. 76.
Hannover, Heinrich/ Hannover-Drück, Elisabeth: Der Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Dokumentation eines politischen Verbrechens, Frankfurt 1967.
Hill, Leonidas (Hrsg.): Die Weizsäcker-Papiere 1900–1932, Berlin 1982.
Wette, Wolfram: Gustav Noske – Eine politische Biographie, Düsseldorf 1987.
Klaus Gietinger
Dezember 2021
Zitierempfehlung:
Gietinger, Klaus: „Der Prozess um die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, Deutschland 1919“, in: Groenewold/ Ignor / Koch (Hrsg.), Lexikon der Politischen Strafprozesse, https://www.lexikon-der-politischen-strafprozesse.de/glossar/der-prozess-um-die-ermordung-rosa-luxemburgs/, letzter Zugriff am TT.MM.JJJJ.