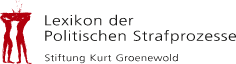China 1980–1981
Agitation gegen die Kommunistische
Partei Chinas,
Sturz der “Viererbande”
Ende der Kulturrevolution
Prozesse gegen die Viererbande
China 1980–1981
Die Große Proletarische Kulturrevolution (1966–1976), initiiert von Mao Zedong (1893–1976), hinterließ tiefgreifende Spuren in China. Die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) schätzte, dass etwa 100 Millionen Menschen – rund ein Achtel der damaligen Bevölkerung Chinas – unter Gewalt litten. Dazu zählten unter anderem außergerichtliche Tötungen, körperliche Übergriffe, Inhaftierungen, qualvolle Verhöre, erzwungene Geständnisse, Folter, sexuelle Gewalt, Eigentumsbeschlagnahmungen und öffentliche Demütigungen. Nach Maos Tod im September 1976 bemühte sich die neue Führung, zunächst unter Hua Guofeng (1921–2008) und später unter Deng Xiaoping (1904–1997), die Hinterlassenschaften dieser Gewalt durch rechtliche und politische Maßnahmen aufzuarbeiten.
Am 6. Oktober 1976 veranlassten Hua Guofeng und Marschall Ye Jianying (1897–1986) die Festnahme von vier Mitgliedern des Politbüros: Wang Hongwen (1935–1992), Zhang Chunqiao (1917–2005), Jiang Qing (1914–1991) und Yao Wenyuan (1931–2005), die national und international als „Viererbande“ bekannt wurden. Die Führung der KPCh bezeichnete die Viererbande zunächst als „parteifeindliche Gruppe“, eine Anschuldigung, die später durch den schwerwiegenderen Vorwurf der Konterrevolution ersetzt wurde. Gleichzeitig geriet die sogenannte Lin-Biao-Clique ins Visier der Führung, bestehend aus hochrangigen Militärs – Huang Yongsheng (1910–1983), Wu Faxian (1915–2004), Li Zuopeng (1914–2009), Qiu Huizuo (1914–2002) und Jiang Tengjiao (1919–2009) – die in einen angeblichen Versuch verwickelt waren, Mao Zedong 1971 zu ermorden. Die KPCh-Führung fasste beide Gruppen als „konterrevolutionäre Cliquen von Lin Biao und Jiang Qing“ zusammen und machte sie für die Gewalt und Ungerechtigkeiten der Kulturrevolution verantwortlich.
Der Prozess, der von November 1980 bis Januar 1981 stattfand, war ein historisches Ereignis, das sowohl in China selbst als auch international ausführlich im Rundfunk und Fernsehen übertragen wurde. Er wurde als öffentliche Abrechnung mit dem Erbe der Kulturrevolution und als Demonstration des Engagements der KPCh für Rechtmäßigkeit inszeniert. Hua Guofeng betonte, dass der Prozess nicht nur das formale Ende der Kulturrevolution bezeichnete, sondern auch die Grundlage für Rechtsreformen legte, die für die politische Transformation Chinas nach der Kulturrevolution von zentraler Bedeutung waren.
Im Folgenden stelle ich den historischen Kontext des Prozesses dar, seinen rechtlichen Rahmen und nenne die Beteiligten, die Verteidigungsstrategien, das Urteil und die langfristigen Auswirkungen. Die Analyse des Zusammenspiels von Recht und Politik zeigt, dass der Prozess sowohl eine rechtliche Abrechnung mit den Gewalttaten während der Kulturrevolution war als auch ein politisches Spektakel zur Legitimierung der Führung nach Mao, dass er jedoch nicht dazu führte, eine tragfähige Rechtsstaatlichkeit zu etablieren.
1. Historischer Kontext
Die Kulturrevolution erschütterte die politische, soziale und rechtliche Ordnung Chinas und setzte selbst hochrangige Kader der KPCh willkürlichen Verfolgungen aus. Um politische Stabilität zu gewährleisten, musste ein Rechtssystem geschaffen werden, das den Einzelnen vor Willkür schützte. Bereits Mitte 1977 forderte Hua Guofeng den Rechtssystem, um die politische und soziale Ordnung wiederherzustellen. Er forderte eine Stärkung der sozialistischen Gesetzlichkeit, um die Ordnung zu festigen. Sozialistische Gesetzlichkeit war ursprünglich ein Modell für den Aufbau legislativer und judikativer Institutionen in der Sowjetunion. In den frühen Jahren der Volksrepublik China (VR China) hatte die KPCh mit Unterstützung sowjetischer Rechtsexperten ähnliche Schritte unternommen, um ihr Rechtssystem aufzubauen. Das Strafgesetz und das Strafprozessgesetz, erstmals in den 1950er Jahren entworfen und in den späten 1970er Jahren überarbeitet, bildeten die rechtliche Grundlage für die Aufarbeitung von Gräueltaten, einschließlich des Prozesses gegen die Viererbande.
Der Prozess gegen die Viererbande fußte auf dem neu verabschiedeten Strafgesetz und Strafprozessgesetz, die einen Wandel hin zu formalisierten rechtlichen Verfahren bezeichnen. Im Gegensatz zu früheren politischen Säuberungen hielt der Prozess gegen die Viererbande an den Prinzipien der öffentlichen Gerichtsverhandlung fest; die Urteile galten als endgültig. Das gesamte Verfahren war sorgfältig inszeniert, um die Schuld auf die angeklagten Cliquen zu konzentrieren und die breitere Führungsebene der KPCh von Vorwürfen freizustellen.
Politische Prozesse waren in Chinakeine Neuheit. Während die KPCh darauf verzichtete, dem Vorbild der Moskauer Prozesse zur Bewältigung innerparteilicher Konflikte zu folgen, spielten Prozesse in China eine wichtige Rolle bei der Bewältigung historischer Gerechtigkeitsfragen. Die Shenyang-Prozesse gegen japanische Kriegsverbrecher im Jahr 1956 gehören zu den bekanntesten Beispielen. Übersetzungen der Urteilssprüche der Nürnberger Prozesse wurden bis 1979 in internen Ausgaben nachgedruckt, weil die Parteiführung überlegte, wie politische Prozesse genutzt werden könnten, um das Erbe der Kulturrevolution aufzuarbeiten. Der Prozess gegen die Viererbande war jedoch in seinem Ausmaß und seiner Sichtbarkeit beispiellos und fungierte sowohl als juristischer Fall als auch als politisches Spektakel.
Parallel dazu fanden auf regionaler Ebene Prozesse gegen mutmaßliche Anhänger der Lin-Biao- und Jiang-Qing-Cliquen statt. Diese Personen, denen häufig vorgeworfen wurde, die Viererbande „aktiv unterstützt“ und während der Kulturrevolution „Schlägereien, Zerstörungen und Plünderungen“ begangen zu haben, wurden in Verfahren angeklagt, deren Ablauf und Ausgang je nach Region unterschiedlich waren. Die meisten Regionen führten diese Prozesse 1982 durch, darunter Peking, Shanghai und das Militärgericht der Volksbefreiungsarmee. In einigen Regionen fanden Prozesse jedoch bereits vor Inkrafttreten der Gesetze von 1980 statt, gestützt auf die Verfassung von 1978 und die Verordnungen der VR China zur Bestrafung von Konterrevolutionären. So wurde beispielsweise Weng Senhe (1937–2023), ein ehemaliger Rebellenführer in der Provinz Zhejiang, im Juli 1978 vor Gericht gestellt und als „neugeborener Konterrevolutionär“ (xinsheng fangeming) zu lebenslanger Haft verurteilt. Ähnlich wurden in Jiangsu und Henan mehrere Angeklagte in den letzten Tagen des Dezember 1979 verurteilt, kurz bevor das Strafgesetz und das Strafprozessgesetz in Kraft traten. Der Grund für die Eile bei diesen Prozessen war, erneute Verfahren nach den neuen Gesetzen zu vermeiden.
In diesen regionalen Prozessen hatten die Angeklagten das Recht, Berufung einzulegen. Dennoch gelang es keinem von ihnen, das Urteil erfolgreich anzufechten, was die politischen Zwänge dieser Strafverfolgungen widerspiegelt. Die regionalen Unterschiede verdeutlichen die uneinheitliche Anwendung von Recht während Chinas Übergangsphase, zeigen jedoch das übergeordnete Ziel der KPCh, vergangenes Unrecht durch rechtliche Mittel aufzuarbeiten und die Ordnung wiederherzustellen.
Insgesamt untersuchten die Behörden zwischen 1976 und 1987 über 480.000 Personen wegen ihrer Rolle in der Kulturrevolution, wobei etwa 210.000 strafrechtliche, parteiinterne oder administrative Sanktionen erhielten. Davon wurden mehr als 20.000 wegen Anstiftung zum Umsturz der Staatsmacht, konterrevolutionärer Propaganda, Mord, Körperverletzung, Vergewaltigung strafrechtlich verfolgt. Darüber hinaus schloss die KPCh zwischen 1979 und 1987 mindestens 317.926 Parteimitglieder aus, von denen viele während der Kulturrevolution der Partei beigetreten waren. Die KPCh bezeichnete diese Personen offiziell als „Täter“ der Kulturrevolution. Diese Zahlen unterstreichen die umfassenden Bemühungen der Regierung, die Gräueltaten der Kulturrevolution aufzuarbeiten und Verantwortlichkeiten zuzuschreiben.
2. Der Prozess gegen die Viererbande
2.1 Angeklagte
Nach dem Dritten Plenum im Dezember 1978 verstärkte die Führung der Kommunistischen Partei Chinas ihre Bemühungen, Mitglieder der beiden Cliquen anzuklagen, und gründete im Juli 1979 das Zentrale Leitungsteam zur Bearbeitung der „zwei Fälle“, nämlich des Falls der Viererbande und des Falls der Lin-Biao-Gruppe. Dieses Zentrale Team stand unter der Leitung von Hu Yaobang (1915–1989), Sekretär des Zentralkomitees der KPCh, der primär für die Aufarbeitung der Kulturrevolution verantwortlich war. Das neu verkündete Strafgesetz und Strafprozessgesetz sollte die rechtliche Grundlage für die Verfolgung dieser „Konterrevolutionäre“ bilden.
Am 26. September 1980 kündigte das Zentrum der KPCh an, zehn führende Mitglieder der beiden Cliquen vor Gericht zu stellen. Zu den zehn Angeklagten gehörten Jiang Qing, Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan, Wang Hongwen sowie Chen Boda (1904–1989, Sekretär Mao Zedongs und politischer Theoretiker) aus der Viererbande sowie Huang Yongsheng (1910–1983), Wu Faxian (1915–2004), Li Zuopeng (1914–2009), Qiu Huizuo (1914–2002) und Jiang Tengjiao (1919–2009) aus der Lin-Biao-Gruppe. Lin Biao, der 1971 gestorben war, wurde nicht angeklagt. Bemerkenswert ist, dass Jiang Tengjiao, von 1967 bis 1971 Politkommissar des Militärbezirks Nanjing, erst im Juni 1980 als Hauptbeschuldigter benannt wurde, nachdem der Angeklagte Wang Fei, stellvertretender Stabschef der Luftwaffe, aufgrund einer Schizophrenie-Diagnose für prozessunfähig erklärt worden war. Der Grund dafür war, dass Jiang Tengjiao eine zentrale Rolle im Zusammenhang mit dem Lin-Biao-Zwischenfall von 1971 gespielt hatte und in früheren Diskussionen bereits für ein Gerichtsverfahren vorgesehen war. Im ursprünglichen Plan von 1979 waren 108 Personen für ein Verfahren vorgesehen, nach mehreren Diskussionsrunden wurde diese Zahl jedoch auf zehn reduziert. Die übrigen Fälle wurden größtenteils vor lokalen Gerichten und Militärgerichten verhandelt. Als sich herausstellte, dass Wang Fei nicht für ein öffentliches Verfahren geeignet war, entschied die Zentrale Leitungsteam zur Bearbeitung der „zwei Fälle“, ihn durch Jiang zu ersetzen, sodass in beiden Fällen jeweils fünf Angeklagte verblieben.
2.2 Anklage und Gerichtsbarkeit
Angesichts der potenziell weitreichenden Konsequenzen des Prozesses wurde im März 1980 ein weiteres hochrangiges Gremium gegründet: das Lenkungskomitee für die Verhandlung der „zwei Fälle“. Dieses einflussreiche Komitee berichtete direkt an das Sekretariat der KPCh und bestand aus Peng Zhen (1902–1997), zugleich Sekretär der Zentralen Kommission für Politik und Recht; Jiang Hua (1907–1999, Präsident des Obersten Volksgerichts); Huang Huoqing (1901–1999, Generalprokurator der Obersten Volksstaatsanwaltschaft); Zhao Cangbi (1916–1993, Minister für öffentliche Sicherheit); Wang Heshou (1909–1999, stellvertretender Sekretär der Zentralen Disziplinarkommission); Peng Chong (1915–2010, Politbüromitglied, das 1976 die Säuberung von Verbündeten der Viererbande in Shanghai leitete); und Wu Xiuquan (1908–1997, Mitglied des Zentralkomitees mit Erfahrung in Diplomatie und Militärangelegenheiten). Viele Mitglieder des Komitees übernahmen später Rollen als Richter oder Staatsanwälte im Prozess.
Am 29. September 1980 verabschiedete der Ständige Ausschuss des Fünften Nationalen Volkskongresses die Entscheidung zur Einrichtung der Sonderstaatsanwaltschaft der Obersten Volksstaatsanwaltschaft sowie des Sondertribunals des Obersten Volksgerichts, um die Hauptschuldigen der Fälle der Lin-Biao- und Jiang-Qing-Gruppen anklagen und verurteilen zu können. Huang Huoqing wurde zum Leiter der Sonderstaatsanwaltschaft ernannt, die mit 21 Staatsanwälten besetzt war. Jiang Hua fungierte gleichzeitig als Präsident des Sondertribunals, das aus zwei Verhandlungskammern bestand. Zeng Hanzhou (1917–2001), Vizepräsident des Obersten Volksgerichts, und Wu Xiuquan leiteten jeweils die erste und zweite Kammer, die mit weiteren 31 Richtern besetzt waren. Das Sondertribunal sollte öffentliche Verhandlungen führen und seine Urteile waren endgültig.
2.3 Verteidigung
Das Strafgesetz und das Strafprozessgesetz schränkten die Möglichkeiten der Verteidigung erheblich ein. Den Angeklagten war es nicht gestattet, ihre Anwälte selbst zu wählen, und die Zuweisung von Verteidigern erfolgte erst spät im Verfahren, nämlich nach der Anklageerhebung. Die ursprünglichen Vorbereitungen für den Prozess sahen einen geheimen Prozess vor und erwähnten keine Verteidiger. Selbst nach der Einrichtung des Sondertribunal und der Sonderstaatsanwaltschaft im März 1980 gab es noch keine konkreten Pläne, Verteidiger in das Verfahren einzubeziehen. Dies bedeutete, dass die Angeklagten während der Voruntersuchungen keinen Zugang zu rechtlichem Beistand hatten.
Die Verteidigung wurde schließlich im Oktober 1980 aus einem Pool von 18 erfahrenen Anwälten übernommen, die speziell vom Justizministerium ausgewählt worden waren. Diese Einschränkung bereitete insbesondere Jiang Qing Schwierigkeiten, die zunächst die renommierte Rechtswissenschaftlerin Shi Liang als Verteidigerin angefordert hatte. Der Antrag wurde abgelehnt, mit der Begründung, die achtzigjährige Anwältin sei zu gebrechlich, um vor Gericht aufzutreten. Nachdem weitere Anträge zurückgewiesen worden waren, erklärte sich Jiang Qing bereit, mit den vom Gericht ernannten Anwälten zu sprechen, lehnte deren Dienste jedoch ab, als sie erfuhr, dass diese weder in ihrem Namen aussagen noch Fragen für sie beantworten durften. Auch Zhang Chunqiao verweigerte die Unterstützung eines Verteidigers, als ihm die Anklageschrift überreicht wurde, und soll erklärt haben, er stimme der Anklage weder zu noch akzeptiere er sie. Wang Hongwen verzichtete ebenfalls auf rechtliche Vertretung. Yao Wenyuan, Chen Boda und mehrere Angeklagte der Lin-Biao-Gruppe nahmen hingegen die vom Gericht zugewiesenen Verteidiger an.
2.4 Anklage
Die Angeklagten sahen sich vier Hauptanklagepunkten gegenüber, die 48 spezifische Vergehen umfassten: (1) systematische Verleumdung und Verfolgung von Parteifunktionären sowie führenden Persönlichkeiten des Staates und Militärs; (2) Verfolgung von über 700.000 niederrangigen Kadern und Bürgern, die zu nahezu 35.000 Todesfällen führte; (3) Planung eines nicht ausgeführten Attentats und eines militärischen Staatsstreichs (zugeschrieben der Lin-Biao-Clique); sowie (4) Versuch einer bewaffneten Rebellion in Shanghai während der Nachfolgekrise nach Maos Tod (Viererbande). Bei der Vorbereitung der Anklageschrift forderte das Zentralkomitee der KPCh ausdrücklich, dass der Prozess keine Fehler, Versäumnisse oder Schwächen der Parteiführung oder staatlicher Amtsträger beinhalten dürfe. Der Prozess sollte sich ausschließlich auf strafbare Handlungen konzentrieren und politische Fehltritte oder Fragen aussparen. Das Verfahren erstreckte sich über sechs Wochen, von Ende November bis Ende Dezember 1980, und umfasste die Anhörung der zehn Angeklagten, die Auswertung von 49 Zeugenaussagen sowie die Prüfung von 651 Beweismitteln.
Politische Diskussionen drehten sich zunehmend um das Konzept sozialistischer Demokratie und sozialistischer Legalität, das einen Bruch mit früheren Praktiken signalisieren sollten. Rechtmäßige Verfahren – anstelle von Rache oder geheimer Verfolgung – sollten die Anklageerhebung gegen die Beschuldigten leiten. Damit der Prozess aufklärerische Funktionen erfüllen konnte, wurde besonderes Augenmerk auf die Verfahrensweise und die Inszenierung gelegt, einschließlich der Regeln für die Gerichtspolizei, der Ordnung im Gerichtssaal und der Rolle der Verteidiger.
2.5 Verteidigungsstrategien
Cook (2016) kategorisiert in seinem Buch die unterschiedlichen Verteidigungsstrategien der Angeklagten vor Gericht in vier Typen. Wang Hongwen, Yao Wenyuan und die meisten anderen Angeklagten verfolgten konventionelle Strategien, die sich in zwei Formen unterteilen lassen: Geständnis bzw. Leugnung. Wang Hongwen, der zusammen mit mehreren anderen eine Geständnisstrategie verfolgte, gestand seine Schuld ein und bat um Milde. Yao Wenyuan hingegen bestritt die Anklagen und machte von den ihm durch das Strafprozessrecht eingeräumten Verfahrensrechten Gebrauch. Mit Unterstützung seines Anwalts korrigierte er einige Detailfragen und erklärte, er habe lediglich auf Befehl gehandelt. Wang Hongwen und Yao Wenyuan entsprachen insgesamt den Erwartungen des Gerichts und hatten kaum Einfluss auf das Ergebnis, was den vorab festgelegten Charakter des Prozesses widerspiegelt.
Im Gegensatz dazu wendeten Zhang Chunqiao und Jiang Qing unkonventionelle Strategien an. Zhang Chunqiao verharrte während des gesamten Prozesses in Schweigen und verweigerte jede Zusammenarbeit mit dem Gericht. Jiang Qing, die sich selbst verteidigte, berief sich auf die revolutionäre Ideologie und erklärte: „Auflehnung ist gerechtfertigt!“ Sie stellte ihre Handlungen als loyal gegenüber Mao dar, betonte, dass diese über juristische Urteile erhaben seien, und warf dem Gericht vor, Mao selbst zu diffamieren. Diese Strategie zielte nicht nur darauf ab, die Wirksamkeit des Gerichtsrituals durch die Störung seiner Inszenierung zu untergraben; ihre Verteidigung stellte die Legitimität des Prozesses als fairen Wettstreit grundsätzlich infrage ebenso wie die unkonventionellen Strategien von Jiang Qing und Zhang Chunqiao die Legitimität des Prozesses und die Behauptung eines fairen rechtlichen Verfahrens verneinten.
2.6 Urteil
In insgesamt 42 Sitzungen zwischen dem 20. November 1980 und dem 25. Januar 1981 hörte das Gericht 49 Zeugen, prüfte 873 Beweismittel und beriet über 26 Urteilsentwürfe. Dennoch gab es anhaltende Meinungsverschiedenheiten über die angemessene Strafe, beispielsweise darüber, ob die Todesstrafe verhängt werden sollte. Nach Abwägung von Stellungnahmen politischer und juristischer Expertengruppen wurden alle zehn Angeklagten für schuldig befunden und zu Strafen verurteilt, die von 16 Jahren Haft bis hin zur Todesstrafe mit zweijährigem Aufschub (für Jiang Qing und Zhang Chunqiao) reichten, die später in lebenslange Haft umgewandelt wurde. Das Gericht vermied es, die breitere Führung der KPCh zu belasten, und betonte die individuelle Verantwortung.
3. Wirkung und Nachwirkungen
Der täglich im Fernsehen übertragene Prozess fesselte ein Massenpublikum und bot Einblicke in die politischen Intrigen der Kulturrevolution. Er trug zur Popularisierung des neuen Strafgesetzes und Strafprozessgesetzes bei und unterstrich das Engagement der KPCh für Rechtsreformen. Die Reaktionen waren jedoch unterschiedlich: Einige kritisierten die Nachgiebigkeit der Anklage, während andere die Rechtmäßigkeit des Prozesses selbst infrage stellten. Jiang Hua verteidigte den Prozess und betonte die Prinzipien „Suche der Wahrheit in den Tatsachen“ und „Handeln nach dem Gesetz“, obwohl Kritiker wie Chiu (1981) ihn als „politischen Schauprozess“ bezeichneten, der vom Rachebedürfnis überlebender Parteigranden gegenüber den radikalen Kräften getrieben gewesen sei.
Der Prozess konnte keine dauerhafte Rechtsstaatlichkeit etablieren, da Strafverfolgungen weiterhin politische Gegner ins Visier nahmen. Wissenschaftler wie Harris (1981) betonen, dass er weder westliche Menschenrechtsstandards noch sozialistische Verfahrensgerechtigkeit erfüllte. Hsiung (1981) behauptet, dass seine politische Bedeutung seine rechtliche Wirkung übertraf, während Terrill (1999) ihn in den breiteren Kontext des chinesischen Kampfes um Handlungsfähigkeit bei repressiven Strukturen einordnet. Die selektive Anklage, rückwirkende Gesetze und prozessuale Unregelmäßigkeiten unterstrichen, dass hier Rechtsprechung und politisches Theater verquickt wurden.
Cook (2016) stellt infrage, ob der Prozess lediglich ein Schauprozess gewesen sei, und hebt seine Rolle bei der Schaffung von Raum für Dissens hervor, wie etwa bei lokalen Prozessen in Nantong, wo öffentliche Verfahren es ermöglichten, den offiziellen Diskurs zur Schuldfrage der Kulturrevolution herauszufordern. Dennoch offenbart das vorsichtige Vorgehen der KPCh – die Begrenzung von Prozessen, um Instabilität zu vermeiden – die Spannung zwischen Gerechtigkeit, Stabilität und Legitimität bei der Aufarbeitung staatlich beförderte Gewalt.
Der Prozess gegen die Viererbande markiert einen historischen Übergang: Er steht für den Wandel vom Chaos der Kulturrevolution hin zu den Reformen der Nach-Mao-Ära. Er symbolisiert den Abschied von außergesetzlichen Säuberungen, doch sein politischer Charakter schränkte seine Legitimität deutlich ein. Indem die Schuld wenigen Personen auferlegt wurde, vermied die KPCh jede tiefere Auseinandersetzung mit den systemischen Problemen – ein Beispiel für die Grenzen von Übergangsgerechtigkeit in autoritären Regimen. Das Vermächtnis des Prozesses liegt in seiner doppelten Funktion: als rechtlicher Meilenstein und als politisches Spektakel, das Chinas Weg zur Modernisierung prägte und gleichzeitig die Herausforderungen einer Versöhnung von historischer Gerechtigkeit mit gesellschaftlicher Stabilität aufzeigte.
Quellen und Literatur
Cook, Alexander C. The Cultural Revolution on Trial: Mao and the Gang of Four. Cambridge, UK; New York, NY: Cambridge University Press, 2016.
Chiu, Hungdah. “Certain Legal Aspects of the Recent Peking Trials of the ‘Gang of Four’ and Others,” in James C. Hsiung ed. Symposium: The Trial of the “Gang of Four” and Its Implication in China. Occasional Papers/Reprints Series in Contemporary Asian Studies 40. Baltimore: University of Maryland, 1981.
Harris, Lillian Craig, “Images and Reality: Human Rights and the Trial of the Gang of Four,” in James C. Hsiung ed. Symposium: The Trial of the “Gang of Four” and Its Implication in China. Occasional Papers/Reprints Series in Contemporary Asian Studies 40. Baltimore: University of Maryland, 1981.
Hsiung, James C. ed. Symposium: The Trial of the “Gang of Four” and Its Implication in China. Occasional Papers/Reprints Series in Contemporary Asian Studies 40. Baltimore: University of Maryland, 1981.
Leese, Daniel. Maos langer Schatten: Chinas Umgang mit der Vergangenheit. Kapitel 8. München: C. H. Beck, 2020.
Terrill, Ross. Madame Mao: The White-Boned Demon. Revised Edition. Stanford, CA: Stanford University Press, 1999.
The Maoist Legacy Database. https://maoistlegacy.de/.
Tumen, Xiao Sike. Tebie shenpan: Lin Biao, Jiang Qing fangeming jituan shoushen shilu [Special Trial: True Account of the Trial of the Lin Biao and Jiang Qing Counterrevolutionary Cliques]. Beijing: zhongyang wenxian chubanshe, 2002.
Man Zhang
August 2025
Zitierempfehlung:
Zhang, Man: „Die Prozesse gegen die Viererbande, China 1980–1981“, in: Groenewold/ Ignor / Koch (Hrsg.), Lexikon der Politischen Strafprozesse, https://www.lexikon-der-politischen-strafprozesse.de/glossar/prozesse-gegen-die-viererbande/, letzter Zugriff am TT.MM.JJJJ.