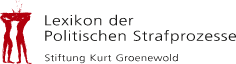Sowjetunion 1936–1939
Verschwörung
Moskauer Prozesse
Schauprozess
Die Moskauer Prozesse
Sowjetunion 1936–1939
1. Prozessgeschichte
Die Moskauer Prozesse waren nicht das Resultat polizeilicher und staatsanwaltlicher Ermittlungen auf Grund empirisch nachweisbarer, sanktionsfähiger Strafdelikte oder auch nur berechtigter Verdachtsmomente, sondern sie wurden begründet und vorbereitet in den höchsten politischen Gremien der Sowjetunion, im Volkskommissariat des Inneren und im Politbüro der KPdSU. Diesen höchsten Parteiinstitutionen unterstanden u.a. die „Kommission für Parteikontrolle“ und die „Kommission für Strafsachen“.
Hier bekam das im Februar 1934 (XVII. Parteitag) gewählte ZK-Mitglied Nikolaj Ivanovič Ežov (1895–1940) ein neues Tätigkeitsfeld zugewiesen. Er wurde mit der Organisation einer umfassenden Parteireinigung (Čistka) beauftragt. Anlass dieser sog. Parteireinigungen war das Attentat auf den Leningrader Parteichef Sergej Mironovič Kirov (1886–1934) vom Dezember 1934. Das Attentat war der erste tödliche Anschlag auf einen hohen Parteiführer im Inland seit der Ermordung des Petrograder Čeka-Chefs, Moissei Solomonowitsch Urickij (1873–1918), im August 1918.
Seit 1935 schrieb Ežov an einer immer wieder präzisierten Vorlage „Von der Fraktionsmacherei zur offenen Konterrevolution“. „In den Entwurf des Typoskripts wurde aufgenommen, daß die ‚Rechten, anstatt die Waffen zu strecken, eine Untergrundorganisation geschaffen haben‘. Stalin stimmte dieser Lesart zu und ordnete an, die ‚Rechtsabweichler‘ zusammen mit den ‚Trotzkisten‘ zu verurteilen“ (Hedeler, Schauprozeß, S. 15, S. 22–27). In seiner ersten Plenarrede im Juni 1935 klagte Ežov einen der ältesten und höchsten Parteifunktionäre der Verschwörung an: Avel‘ Safronovič Enukidse (1877–1937), seit 1922 Sekretär des staatlichen Zentralen Exekutivkomitees der UdSSR. Ende September 1936 übernahm Ežov, als Nachfolger Jagodas, der im Dritten Moskauer Prozess angeklagt wurde, das Volkskommissariat des Inneren (NKWD). Im ständigen Kontakt mit Stalin entwarf Ežov die Struktur und den Ablauf der beabsichtigten Prozesse. Ežov erfand dafür entsprechende Delikte und die dazu passenden Tätergruppen, z.B. Industrie‑, Transport- und Verkehrsverbrechen oder Tötungen (zumeist Vergiftungen und „Unfälle“) von Prominenten, wie Men’žinskij (gest. 10. Mai 1934), Kujbyšev (gest. 25. Januar 1935) oder Gork’ij (gest.18. Juni 1936), deren Tod angeblich durch ihre Kremlärzte verursacht worden sei. Es wurde ein ‚Netz terroristischer Gruppierungen‘ konstruiert, das je verschiedenen Regierungs‑, Sicherheits- und Parteiinstitutionen zugeordnet war. Außerdem wurde ein „Drehbuch“ für die Prozesse verfasst, in dem die Anklagefragen und Täterantworten als Dialoge vorgegeben waren. Geständnisse konnten aus „einem mitgebrachten Heftchen abgelesen werden“ (Hedeler, Schauprozeß, S. 49).
Nach dem zweiten Prozess kam es auf dem Februar-Plenum der Partei 1937 zu einer bemerkenswerten „rechtstheoretischen“ Äußerung Stalins. Er „forderte die Beschuldigten auf, sich in die Lage der Ankläger zu versetzen und endlich aufzuhören, immer wieder neue Fragen zu stellen. Nur weil sie nichts zu ihrer Verteidigung vorbringen könnten, erfinden sie Widersprüche in den sie belastenden Aussagen“ (Hedeler, Schauprozeß, S. 32). Diese Widersprüche betrafen z.B. Orte verschwörerischer Zusammenkünfte wie ein angebliches Treffen mit einem Trotzki-Sendboten im Kopenhagener Hotel Bristol im Herbst 1932, ein Hotel das es aber zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr gab.
Das Gericht tagte bei allen drei Prozessen in Moskau im Haus der Gewerkschaften, in der Großen Dimitrowka-Straße, Nr. 1 (bis 1993 Puschkinstraße). Der Verhandlungsraum war der Oktobersaal mit 470 Plätzen.
Der erste Prozess: „Über die Strafsache das trotzkistisch-sinowjewistische terroristische Zentrum“ fand vom 19.–24. August 1936 statt, der zweite Prozess über „Über die Strafsache des sowjetfeindlichen trotzkistischen Zentrums“ vom 23.–30. Januar 1937 und der abschließende dritte Prozess „Über die Strafsache des antisowjetischen Blocks der Rechten und Trotzkisten“ vom 2.–13. März 1938. Für den dritten Prozess waren 18 Sitzungen vorgesehen. Die Verhandlungen begannen um die Mittagszeit und dauerten bis in den frühen Morgen des nächsten Tages. Schon vor den in offiziellen Medien publizierten Protokollen des ersten Prozesses machte sich auch bei sowjettreuen Beobachtern Skepsis breit. So beispielsweise bei Georgi Dimitroff (1882–1949), der selber in einem politischen Prozess angeklagt und freigesprochen worden war, nämlich im Reichstagsbrandprozess 1934 in Leipzig. Dimitroff, jetzt Chef der „Kommunistischen Internationale“ (Komintern), notierte in sein Tagebuch: „Die Protokolle des Prozesses sind nachlässig zusammengestellt, voller Widersprüche und nicht überzeugend.“ Für den zweiten Prozess hielt er fest: „Es gibt keinerlei Beweise! […] Belastend ist der Eindruck, den die unflätige Beschimpfung der Angeklagten hervorruft. […] Der Trotzkismus ist tot, wozu eine solche Kampagne?“ (Dimitroff, S. 140, 148).
2. Personen
a) Die Angeklagten
aa) Im ersten Prozess waren angeklagt: Ivan Petrovič Bakaev (1887–1936), Chef der Leningrader GPU; Konon W. Berman-Jurin (Pseud. Hans Stauer) (1901–1936), deutscher Komintern-Funktionär, seit 1933 in der Sowjetunion; Efim Alexandrovič Drejcer (1894–1936), Kommandeur der Roten Armee; Grigorij Ermeevič Evdokimov (1884–1936), Volkskommissar f. Lebensmittelindustrie; Eduard Salomonivič Gol’cman (1882–1936), Diplomat in Berlin; Lev Borisovič Kamenev (Rozenfel’d) (1883–1936), seit 1928 Direktor des Instituts f. Weltliteratur und des Akademie-Verlags; Ilja Krugljanski (Pseud. Fritz David) (1897–1936), seit 1929 Redakteur der Berliner „Roten Fahne“; Nathan Lur’e (1901–1936), Chefarzt in Čel’jabinsk; Moisej Il‘ič Lur’e (Pseud. Aleksander Emel) (1897–1936), seit 1934 Historiker an der Moskauer Universität; Sergej Vasil‘evič Mračkovskij (1888–1936), Armeekommandeur im Bürgerkrieg; Valentin Ol’berg (1907–1936), seit 1935 Pädagogikdozent in Gor’kij; Richard Vitol‘dovič Pikel‘ (1896–1936), Literatur- u. Theaterkritiker; Isaak Isaevič Rejngol’d (1897–1936), Volkskommissar f. Landwirtschaft; Ivan Nikitovič Smirnov (1881–1936), Militärführer im Bürgerkrieg, Volkskommissar f. Schwerindustrie; Vargaršak Arutjunovič Ter-Vagan’jan (1893–1936, Journalist u. Herausgeber; Grigori Evseevič Zinov’ev (Radomylskij) (1883–1936); 1919 Gründer und bis 1926 Chef der Komintern.
bb) Im zweiten Prozess waren angeklagt: Valentin Vol’fridovič Arnol’d (1896–?), Wirtschaftsführer; Michail Solomonovič Boguslavskij (1886–1937), Moskauer Parteifunktionär; Jakov Naumovič Drobnis (1891–1937), Vorsitzender des Kleinen Rats der Volkskommissare; Ivan Iosifovič Graše (1886–1936), Kominternfunktionär; Ivan Aleksandrovič Knjazev (1893–1937), Volkskommissar f. Eisenbahnen; Jakov Abrammovič Lifšic (1896–1937), Volkskommissar f. Eisenbahnen; Nikolaj Ivanovič Muralov (1877–1937), seit 1925 Rektor der Timirjazev-Akademie für Landwirtschaft; Boris Osipovič Norkin, Wirtschaftsführer in der Chemieindustrie; Jurij Leonidovič Pjatakov (1890–1937), seit 1929 Chef der Staatsbank; Gavriil Efremovič Pušin (1896–1937), Chefingenieur; Karl Radek (Sobelsohn) (1885–1939), Vertrauter Lenins seit dem Schweizer Exil, seit 1920 Kominternfunktionär; Stanislav Antonovič Ratajčak (1894–1937), Volkskommissar f. Schwerindustrie; Leonid Petrovič Serebrjakov (1890–1937), Chef der Zentralverwaltung f. Verkehrswesen; Aleksej Aleksandrovič Šestov (1896–1937), Wirtschaftsführer in der Montanindustrie; Grigorij Jakovlevič Sokol’nikov (Girš Brilliant) (1888–1939), seit 1934 Kandidat des ZK; Michail Stepanovič Stroilov (1899–?), Wirtschaftsführer in der Montanindustrie; Iosif Dimitrievič Turok (1900–1937), Eisenbahnfunktionär.
cc) Im dritten Prozess waren angeklagt: Sergej Alekseevič Bessonov (1892–1941), Handelsrat bei der Botschaft in Berlin; Nikolai Ivanovič Bucharin (1888–1938), seit Februar 1934 Chefredakteur der ‚Izvestija‘; Pavel Petrovič Bulanov (1895–1938), seit 1921 Čeka-Mitarbeiter; Michail Aleksandrovič Černov (1891–1938), seit April 1934 Volkskommissar f. Landwirtschaft; Fajzulla Ubajdullaevič Chodžaev (1896–1938), seit 1925 Vorsitzender des Rats der Volkskommissare in Usbekistan; Grigori Fedorovič Grinko (1890–1938), seit 1930 Volkskommissar f. Finanzen; Akmal Ikramovič Ikramov (1898–1938), seit 1929 KP-Chef in Usbekistan; Vladimir Ivanovič Ivanov (1893–1938), seit 1931 KP-Chef für die Nordgebiete der UdSSR; Genrich Georgievič Jagoda (1891–1938), seit Juli 1934 Volkskommissar für Inneres; Ignatij Nikolaevič Kazakov (1891–1938), ‚Alternativ‘mediziner im Čeka-Apparat; Nikolaj Nikolaevič Krestinskij (1883–1938), seit 1930 stellv. Außenminister; Pjotr Petrovič Krjučkov (1889–1938), seit 1918 Sekretär von Maxim Gor’kij; Lev Grigor‘evič Levin (1870–1938), Arzt am Kreml-Krankenhaus; Veniamin Adamovič Maksimov-Dikovskij (1900–1938), seit 1932 im Sekretariat des Rats der Volkskommissare; Dmitrij Dmitrievič Pletnev (1872–1938), Medizinprofessor, bedeutendster Mediziner Russlands; Christian Georgievič Rakovskij (1873–1941), Januar 1919 Regierungschef der Ukraine, Kominternmitarbeiter; Arkadi Pavlovič Rozengol’c (1889–1938), seit 1930 Volkskommissar f. Außenhandel; Aleksej Ivanovič Rykov (1881–1938), von 1924–1930 Vorsitzender des Rats der Volkskommissare, d.i. der Nachfolger Lenins; Vasilij Fomič Šarangovič (1897–1938), seit 1934 Parteikontrollkommission, ab März 1937 KP-Chef von Weißrussland; Isaak Abramovič Zelinskij (1890–1938), seit 1934 Chef der Konsumgenossenschaften; Prokopij Timofeevič Zubarev (1886–1938), seit 1934 stellv. Volkskommissar f. Landwirtschaft.
b) Das Gericht
Den Vorsitz aller drei Prozesse führte der Armee-Militärjurist Vasilij Vasil’evič Ulrich (1889–1951), seit 1920 Leiter des Militärkollegiums beim Obersten Gericht. Die übrigen Mitglieder des Gerichts waren: Korps-Militärjurist I. O. Matulevič, Divisions-Militärjurist Iona Timofeevič Nikitčenko (1895–1967), Divisionsmilitärjurist B. I. Ievlev und Divisions-Militärjurist N. M. Rytschkow. Die Sekretäre des Gerichts waren die Militärjuristen I. Ranges A. F. Kostjuschko und A. Batner.
c) Die Verteidiger
Im ersten Prozess verzichteten alle Angeklagten auf eine Verteidigung. Im zweiten Prozess wurde die Verteidigung von drei Mitgliedern des Moskauer Verteidigerkollegiums übernommen: Il‘ja Davidovič Braude (1885–1955) verteidigte den Angeklagten I. A. Knjazev. Der Angeklagte G. E. Pušin wurde von Nikolai Vasil’evič Kommodov und der Angeklagte V. V. Arnol’d von S. K. Kasnadshe‘ev verteidigt. Im dritten Prozess verteidigte I. D. Braude den Angeklagten Medizinprofessor L. G. Levin, während die beiden anderen Mediziner I. N. Kazakov und D. D. Pletnev von N.V. Kommodov verteidigt wurden.
3. Zeitgeschichtliche Bedeutung
Die Moskauer Prozesse veränderten die Herrschafts- und Legitimationskultur in der Sowjetunion grundlegend. Sie justifizierten und beendeten die Variabilität, die gesellschaftspolitischen Differenzen und die unterschiedlichen sozialtechnischen Strategien, die vor dem XV. Parteitag der KPdSU im Dezember 1927 noch offen diskutiert und in klaren Gruppierungen personell und programmatisch erkennbar waren.
Die nationalökonomische Hauptfrage nach dem ersten Dezennium der Sowjetgesellschaft (seit 1917) war: sollte man weiter den Kriterien der „Neuen Ökonomischen Politik“ (NEP), seit 1921, folgen? Oder sollte eine umfassende „Planwirtschaft“, welche bislang nur in Not- also Kriegszeiten aktivierte wurde, beginnen?
Mit der NEP, einer wirtschaftspolitischen Wende, um den Kriegskommunismus zu beenden, kam es zu einer Liberalisierung in der Landwirtschaft, im Handel und in der Industrie, die den Betrieben und Bauern teilweise marktwirtschaftliche Methoden zugestand. Die NEP stellte damit in Maßen die ökonomische Freizügigkeit in den Dörfern und die Handelsfreiheit in den Städten wieder her. Auf der Alltagsebene der sich nun wieder ausdifferenzierenden Gesellschaft erschien das vielen wie eine Wiederkehr „kapitalistischer“ Strukturen in der Wirtschaft und bei den Menschen. Denn die heroische Mentalität wurde zugunsten bilanzierender und rechnender Klugheit und Selbstverantwortung marginalisiert. Der „NEP-Mann“ war ein bevorzugtes Hassobjekt der linken Propaganda.
Dieser Kurs endete als Stalin die politisch-moralische Situation neu definierte: „Man mußte offenbar zwischen zwei Plänen wählen: zwischen dem Plan des Rückzugs, der zur Niederlage des Sozialismus geführt hätte, und dazu hätte führen müssen, und dem Plan des Angriffs, der zum Sieg des Sozialismus in unserem Lande führte, und, wie ihr wißt, bereits geführt hat“ (Stalin, Rede v. 4. Mai 1935). Damit war ein ordnungsphilosophisches Prinzip aufgestellt, dem auch die Rechtspraxis zu folgen hatte: Unter Gleichgesinnten konnte es nicht zwei unterschiedliche Meinungen oder gar zwei unterschiedliche Wege zum selben sozialpolitischen Ziel geben. Eine abweichende Meinung war nach dieser Definition ein Rückweg, der zur Restauration führte und damit konterrevolutionär und hochverräterisch war. Damit war eine abweichende Haltung eben keine „Meinung“, sondern wurde zum Verbrechen. Deshalb brauchte dem Verdächtigten auch nicht eine konkrete kriminelle Tat, ein realer Sachbeweis nachgewiesen werden, sondern es genügte bereits, eine abweichende, andere – nicht „linientreue“ – Meinung (= Agitation) zu artikulieren (Artikel 58–10 des Strafgesetzbuchs der RSFSR vom 25. Februar 1927).
Ab 1928 begann das Wirtschaften nach Fünfjahresplänen. Damit wurde der „Sozialismus-in-Einem-Land“ als geschlossener Militärstaat (Kasernensozialismus, Befehlswirtschaft) weltmarktwirtschaftlich von der globalen Kommunikation ausgegliedert. Das machte sich sofort katastrophal bemerkbar: Für die Gesamtplanung musste (ohne hinreichendes Ingenieurs- und Verwaltungswissen) ein so noch nie dagewesenes totales Produktionsgefüge geschaffen werden, mit erstens ortsfesten Industriearbeitern, zweitens mit Bauern, die als Landarbeiter (zwischen 1928 und 1933) vom Eigentum und vom Land getrennt wurden, drittens einer „Arbeitsarmee“ (Trudarmija) als militarisierte Form der Arbeit, und viertens mit der Zwangsarbeit aller Strafgefangenen, die durch die „Hauptverwaltung Lager“ (Главное управление лагерей, seit 1934 GULag) organisiert wurde. In der Industrie wurden die alten und veralteten Produktions- und Verkehrssysteme auf Hochtouren gefahren bzw. Neues mit ungeheurem Furor, aber ohne neueste Technik, Erfahrung und Ressourcen, „auf die grüne Wiese“ gesetzt. Dabei war abzusehen, dass es massenhaft zu Störungen, Ausfällen, Unfällen und Zusammenbrüchen kommen musste, verursacht durch mentale Inkompetenz, Schluderei, Überforderung, Improvisation, Rat- und Verantwortungslosigkeit, kurz: durch ein schon von Lenin auch an seinen Genossen kritisiertes „Oblomovtum, das die Sache zugrunde richtet“ (Lenin, 24. Januar 1922).
Besonders gravierend wirkte sich im Agrarland Russland die Verwandlung von Bauern in Landarbeiter aus: Die politisch gewollte Gewalt-Kampagne, die Bauern in kürzester Zeit und massenhaft aus ihrem Arbeitsmilieu herauszunehmen, hatte allerdings unter Sowjet-Bedingungen sofort einen Verwaltungs‑, Verkehrs- und Ernährungskollaps zu Folge, der von „oben“ her kaum zu beherrschen war. Ein Versuch der Gegensteuerung aus dem Jahr 1930 von Stalin selbst kam zu spät. Die grauenhaften Folgen mit Millionen von Hungertoten (1931/1932) hatte das ganze Land zu tragen und nicht nur die „Zielgruppe“ der Enteigneten.
Diese Versorgungs- und Produktionskatastrophen mussten erklärt und geklärt und die Schuldigen daran zur Rechenschaft gezogen werden. Aber: Wer war an der Misere schuld? Aus Sicht der Machthaber war das nicht das ungestüme Aufbaustreben der „Erbauer des Kommunismus“, sondern die, die immer schon – mit „spitzer Feder“ – gegen die ausufernde Planstrategie opponiert hatten, und die jetzt nicht nur eine systematische „Fehlerdiskussion“ begannen, sondern inzwischen offensichtlich auch vor Hochverrat und (Prominenten-)Mord nicht zurückschreckten.
Weil sich nach 1927 die alten Oppositionsgruppen – als ‚Rechte‘ (um Bucharin) oder ‚Linke‘ (um Trotzki) stigmatisiert – entschieden selbstkritisch zur Einheit der Partei und einer einheitlichen Strategie bekannten – (mit exemplarischen Loyalitätserklärungen, wie 1927 die „Erklärung der 121“), und die Mehrheiten der Parteibasis anerkannten, blieben sie größerenteils noch weiter in der Partei‑, Staats‑, Militär- und Wirtschaftsführung tätig, wenn auch nicht mehr in Führungspositionen. Jetzt aber, zehn Jahre später, saßen alle Redner des Parteitages von 1927 (außer Stalin und der Krupskaja, Lenins Witwe) auf der Anklagebank oder waren bereits tot. Mit ihren weitverzweigten gesellschaftlichen Beziehungen – sie hatten schließlich den Bürgerkrieg und das erste Aufbaujahrzehnt organisiert, – wurden sie nun als die Urheber und Auslöser aller Mängel, Fehler, Ineffektivität und vor allem Sabotage der Planwirtschaft namhaft gemacht. Die neuen Propagandafiguren dafür waren: der Doppelzüngler und die Fünfte Kolonne.
In der Herrschaftskultur, so wie sie seit 1927 von Stalin dominiert wurde, bahnte sich eine Krise an, als Sergej Mironovič Kirov (1886–1934), seit Februar 1926 Leningrader Parteichef, auf dem XVII. Parteitag im Frühjahr 1934 ins höchste Führungsgremium der Partei gewählt wurde. Dieser, so heißt es im Schrifttum, habe „teilweise wieder den alten liberalen Geist (belebt), der Leningrad in der Zeit nach der Revolutionsperiode zu einem kulturellen und wissenschaftlichen Mittelpunkt gemacht hatte, und er führte die Versöhnungspolitik in seinem eigenen Bezirk, soweit es nur irgend ging, durch.“ (Barmine, S. 353). Am 1. Dezember 1934 wurde Kirov im Smol’nyj, der alten Zentrale der Revolution, in Leningrad von einem Attentäter getötet. Das bot die Gelegenheit, die Parteireinigung jetzt nicht mehr bloß politisch-organisatorisch, sondern auch rechtsförmig zu exekutieren. Die offiziellen Untersuchungen zum Kirov-Attentat sind weder in den 1930er Jahren noch nach dem XX. Parteitag (1956) zu einem überprüfbaren und belastbaren Ergebnis gekommen.
Die Prozesse korrigierten mit ihren Verurteilungen zugleich auch die in geheimer Wahl getroffenen Personalentscheidungen des XVII. Parteitags, des „Parteitages des Sieges“ (26. Januar–10. Februar 1934). Nicht nur, dass hier die ehemaligen Moskauer bzw. Leningrader Sowjetchefs Kamenev und Zinov’ev angeklagt wurden, auch ihre Nachfolger Konstantin Vasil’evič Uchanov (1891–1937) und Nikolaj P. Komarov (F.J. Sobinov) (1886–1937) wurden liquidiert. Von 139 gewählten Mitgliedern und Kandidaten dieses Parteitags wurden in den drei Prozessen und mehreren nichtöffentlichen Nachfolgeprozessen 99 Personen angeklagt und verurteilt, davon 44 Mitglieder von 71, und 55 Kandidaten von 68 der Parteiführung.
4. Anklage
Die Anklage vertrat der Generalstaatsanwalt der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, Andrei Januar‘evič Vyšinskij (1883–1954). Er war seit 1935 in diesem Amt. Sein Vorgänger war Ivan Alekseevič Akulov, der 1937 selbst von einem Militärgericht zum Tode verurteilt wurde. Nach dem Mord an Kirow wurde durch den Beschluss des Präsidiums des Zentralen Exekutivkomitees noch am Tag des Attentats eine Änderung in der Strafprozessordnung der Unionsrepubliken angeordnet. Die Strafprozessordnung (StPO) der RSFSR in der revidierten Fassung vom 15. Februar 1923 wurde durch Anordnung des Zentralen Exekutivkomitees am 10. Dezember 1934 um die Artikel 466 bis 470 ergänzt. Das betraf die Erweiterung von Ermittlungsverfahren wegen terroristischer Organisationen und Terrorakten gegen Personen und Sachen der Sowjetmacht durch Übergabe an einen Untersuchungsführer der Militärstaatsanwaltschaft und die schnelle Durchführung der Verfahren (§§ 466–468), die Nichtzulassung von Beschwerden (§ 469) und schließlich die schnelle Exekution (§ 470).
Die Hauptanklage in den drei Prozessen bestand in dem Vorwurf der Organisation einer verräterischen Verschwörung, gemäß Artikel 58–1‑a und 58–11 StGB. Das einzige Beweismaterial der Anklage bestand in den staatsanwaltlichen Beschuldigungen und in den Geständnisse der Angeklagten: „Diese Anklage ist bewiesen“, so hieß es im Schlussplädoyer des dritten Prozesses, „durch die Geständnisse aller Angeklagten, sogar jener, die sich nicht voll oder teilweise irgendeines anderen Verbrechens schuldig bekannt haben“ (Vyšinskij, S. 714). Obwohl Geständnisse der Königsweg der Anklage blieben, machte deren Inflation auch den Ankläger gelegentlich nervös. In seinem Schlussplädoyer zum dritten Prozess unterstrich Vyšinskij seine Wendung hin zum Objektiven in einem Tatgeschehen mit den Worten: „Das ist eine Tatsache, das ist keine Selbstbeschuldigung, das ist eine Tatsache“ (Vyšinskij, S. 614).
5. Verteidigung
Gerade Kommodov, Verteidiger von D. D. Plentev im dritten Prozess, leistete es sich anfangs noch, die Argumentation des Staatsanwaltes gelegentlich in Frage zu stellen. Doch bald arbeitete die Verteidigung „Hand in Hand mit Vyšinskij und begann ihr Plädoyer mit einer prinzipiellen Zustimmung zur Anklageformel“ (Hedeler, Schauprozeß, S. 51). Entlastende Passagen aus den Verteidigerreden wurden im veröffentlichten Prozessbericht getilgt.
6. Urteil
Im ersten Prozess wurden alle 16 Angeklagten zum Tode verurteilt, die Todesstrafe wurde am 25. August 1936 vollstreckt. Im zweiten Prozess wurde die Todesstrafe über 13 Angeklagte verhängt, das Urteil wurde am 30. Januar 1937 vollstreckt. Die Angeklagten Arnol‘d, Sokol’nikov und Radek wurden zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt, der Angeklagte Stroilov zu acht Jahren; ihnen wurden außerdem für den Zeitraum von fünf Jahren alle politischen Rechte entzogen.
Im dritten Prozess erhielten 18 Angeklagte die Todesstrafe, die am 15. März 1938 vollstreckt wurde. Die Angeklagten Rakovskij und Pletnev wurden zu zwanzig Jahren Gefängnis, der Angeklagte Bessonov zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Für die Dauer von fünf Jahren wurden ihnen die politischen Rechte entzogen.
7. Wirkung
Eine bedeutende innerparteiliche Folge der Prozesse war, dass mit dem XVIII. Parteitag (10.–21. März 1939 in Moskau) eine wichtige Änderung im Parteistatut vorgenommen wurde, der zufolge „Massenreinigungen“ nicht mehr legitim waren. „Es muß hier betont werden“, sagte der Nachfolger Kirovs in seinem Bericht an den Parteitag (am 18. März 1939), „daß die Massenreinigungen bei der Festigung der Partei eine gewaltige Rolle gespielt haben. (…) Die negative Seite der Massenreinigungen besteht darin, daß durch den kampagnenmäßigen Charakter der Massenreinigungen viele Fehler verursacht werden, vor allem im Sinne einer Verletzung des Leninschen Prinzips des individuellen Herangehens an die Menschen“ (Ždanov, S. 21). Am 25. November 1938 hatte Ežov sein Amt als Volkskommissar des Inneren verloren, am 10. April 1939 wurde er verhaftet.
Für alle Beobachter der Prozesse waren die ausnahmslosen, fast gleichgültig offenbarten Geständnisse aller Angeklagten ein Rätsel. Als einziger hat im dritten Prozess Krestinskij einmal – eine Verhandlungssequenz lang – seine Schuldlosigkeit betont. Dass sich hier eine – schreckliche – Manipulation finden lassen könnte, war vor allem bei Sympathisanten der Sowjet-Idee völlig undenkbar, so beispielsweise Lion Feuchtwanger 1937: „Wenn das gelogen war oder arrangiert, dann weiß ich nicht, was Wahrheit ist“ (Feuchtwanger, S. 119). Die Angeklagten waren doch alle in Zeiten von Revolution und Bürgerkrieg gewalt- und terrorerprobte Akteure gewesen, stolz auf ihre entschlossene Umkrempelung des alten Russland. Hier standen offensichtlich keine trotzigen Ketzer vor Gericht, die sich mit einem „Sancta Simplicitas“ oder einem „Eppur si muove!“ verabschiedeten. Machten sich hier erstmals in der neueren europäischen Geschichte wieder Märtyrer einer neuen Politischen Theologie bemerkbar?
Im Ausland wurde vor allem diskutiert, wie und als was man diese Prozesse zu begreifen hätte. Übergreifend machte sich der Terminus „Schauprozess“ geltend. In der deutschen Presse kam ein neuer Begriff für diese Veranstaltungen in Moskau auf: „Theaterprozess“. Mit dieser Bezeichnung kam man der Wahrheit schon sehr nahe, obwohl man damals natürlich noch nicht von dem höchstinstanzlichen „Drehbuch“ zu diesem Spektakel wusste. „Was soll man denken“, notierte sich Thomas Mann, „von all diesen reuigen Geständnissen, denen das allgemeine Todesurteil folgte. (…) Üble Rätsel“ (Th. Mann, S. 358 f.).
Im Bild der Sowjetunion machte sich sowohl bei Sympathisanten als auch bei Gegnern die ahnungsvolle Einsicht Dostojewskis in das „Karamasov“-Syndrom russischer Revolutionäre geltend, nämlich: sie seien „nicht gewachsen dem Aufruhr, den sie selber anzettelten“ (Dostojewskij, S. 468).
8. Würdigung
Die Moskauer Prozesse sind singulär in der neueren europäischen Rechts- und Staatsgeschichte. Durch ihre Rechts- und Verfahrenspraxis wurden die wichtigsten diskursiven Paradigmen verlassen, die man neuzeitlich mit dem Begriff des Rechts verbindet. Dass ein Generalstaatsanwalt in seinem Schlussplädoyer Bürger seines Landes, die ihm als Staatsführer, Diplomaten, Journalisten oder Militärs gedient hatten, mit dem Satz beschimpft: „Ich fordere, daß diese tollwütigen Hunde allesamt erschossen werden!“ (Vyšinskij, S. 543) und damit auch vor die Öffentlichkeit tritt, ist zugleich auch ein Beleg für den geistig-moralischen Zustand eines Rechts, wenn es eben bloß Instrument des Machtstaats ist. Die Moskauer Prozesse wurden folglich von ihren Akteuren selbst als „ein Sieg des Stalinismus“ bewertet (Kaganovič, S. 217).
9. Literatur
Prozessbericht über die Strafsache des trotzkistisch-sinowjewistischen terroristischen Zentrums, v. 19.–24. August 1936, Moskau 1936; Prozessbericht über die Strafsache des sowjetfeindlichen Zentrums, v. 23.–30. Januar 1937, Moskau 1937; Prozessbericht über die Strafsache des antisowjetischen Blocks der Rechten und Trotzkisten, v. 2.–13. März 1938, Moskau 1938; Bucharin-Prozess 1938, hg. v. Sch. W. Artamonova u. N. W. Petrow, Moskau 2013 (russ.); Process antisovetskogo trockistskogo centra 23–30 janvarja 1937, Hg. Nikolai Starikov. Sankt Peterburg: Piter 2015; Sudebnyj otcet po delu antisovetskogo pravo-trockistskogo bloka (1938). Hg. Nikolai Starikov. Sankt Peterburg: Piter 2014; Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Berlin, (PA AA, Fasz. 72, 76, 106: Innenpolitische Verhältnisse SU; und 107 A 2m: Trotzkisten-Prozess März 1938).
Alexander G. Barmine, Einer der entkam, Wien (1948), S. 353; Ernst Bloch, Kritik einer Prozesskritik. Hypnose, Mescalin und die Wirklichkeit, in: Die neue Weltbühne (Prag), Nr. 10, v. 4. März 1937, S. 294–299; Ernst Bloch, Bucharins Schlusswort, in: Die neue Weltbühne, Nr. 18, v. 5. Mai 1938, S. 558–563; Boris Souvarine, Stalins Schweigen, in: Das Neue Tage-Buch, 6 (1938), Heft 45 (v. 5. November 1938), S. 1066–1071; John Dewey u. a., The Case of Leon Trotsky. Report of Hearings on the charges made against him in the Moscow Trials. Harper & Brothers, London / New York 1937; Georgi Dimitroff, Tagebücher 1933–1943, hg. v. Bernhard H. Bayerlein, Berlin 2000, Bd. 1; Fjodor M. Dostojewskij, Die Brüder Karamasov, Sämtliche Romane u. Novellen, Bd. 23, Leipzig 1921, S. 468; Lion Feuchtwanger, Moskau 1937, Amsterdam 1937, S. 119; Wladislaw Hedeler, Chronik der Moskauer Schauprozesse 1936, 1937 und 1938. Mit einem Essay von Steffen Dietzsch, Planung, Inszenierung und Wirkung, Berlin 2003; Wladislaw Hedeler, Die Szenarien der Moskauer Schauprozesse 1936–1938, in: Utopie kreativ [Berlin], Heft 81/82 (Juli/August) 1997, S. 58–75; Wladislaw Hedeler, Moskauer Schauprozeß gegen den ‚Block der Rechten und Trotzkisten‘. Von Jeshows Szenario bis zur Verfälschung des Stenogramms zum ‚Prozeßbericht‘, Berlin 1998; Moskau 1938. Szenarien des Großen Terrors, Hg. v. Klaus Kinner, Leipzig 1999; Wladimir I. Lenin an Alexander D., Zjurupa, v. 24. Januar 1922, in: Lenin, Werke, Bd. 35, Berlin 1979, S. 515 (erstmals ediert 1927); Thomas Mann, Tagebücher 1935–1936, Hg. v. Peter de Mendelssohn, Frankfurt/M. 1978, S. 358 f. (Eintrag v. 25. August 1936); Lazar‘ Moiseevič Kaganovič an Grigorij Konstantinovič (Sergo) Ordžonikidse v. 4. September 1935, in: Oleg Chlevnjuk, Das Politbüro, Hamburg 1998, S. 217; Willi Schlamm, Diktatur der Lüge. Eine Abrechnung, Zürich 1937; Leopold Schwarzschild, Der ‚Gestapomann Trotzki‘, in: Das Neue Tage-Buch [Paris], 4 (1936), Heft 35 (v. 29. August 1936), S. 824–828; Rotbuch über den Moskauer Prozess. Dokumente, gesammelt und redigiert von L(eo). Sedow, Antwerpen 1937 (Neudruck: Frankfurt/M. 1972 u. 1988); Josef W. Stalin, Die Technik und die Menschen (Rede am 4. Mai 1935), in: Sowjetunion 1935. Reden und Berichte, Moskau/Leningrad 1935, S. 17; Andrej J. Vyšinskij, Gerichtsreden, 1948, (dt. 1951), (d.i.: Schlußplädoyers: am 24. August 1936: S. 494–543; am 30. Januar 1937: S. 550–620; am 13. März 1938: S. 628–718); Andrej A. Ždanov, Abänderungen am Statut der KPdSU (B), Moskau 1939, S. 21; Russische Dokumente zum ‚Gestapomann Trotzki‘, in: Das Neue Tage-Buch, 4 (1936), Heft 37, S. 871–873. https://gedenkbibliothek.de/download/Dr_Otto_Wenzel_Die_Moskauer_Schauprozesse_1936_1937_und_1938_vom_25_01_2011.pdf
Steffen Dietzsch
September 2015
Steffen Dietzsch ist Gründungsdirektor des Kondylis-Instituts für Kulturanalyse in Berlin. 2001/02 war er erster „Fellow-in-Residence“ am Kolleg Friedrich Nietzsche in Weimar. Arbeitsschwerpunkte sind Themen zu Kant & Deutschem Idealismus, zur Kulturphilosophie des XX. Jh. Zu seinen neueren Buchpublikationen gehört „Nietzsches Perspektiven“ (2014) und „Denkfreiheit“ (2016).
Zitierempfehlung:
Dietzsch, Steffen: „Die Moskauer Prozesse, Sowjetunion 1936–1939“, in: Groenewold/ Ignor / Koch (Hrsg.), Lexikon der Politischen Strafprozesse, https://www.lexikon-der-politischen-strafprozesse.de/glossar/bucharin-nikolai-iwanowitsch-grigori-jewsejewitsch-sinowjew-lew-borissowitsch-kamenew-alexei-iwanowitsch-rykow-leo-trotzki-georgi-leonidowitsch-pjatakow-und-karl-radek-u‑a, letzter Zugriff am TT.MM.JJJJ.
Abbildungen
Verfasser und Herausgeber danken den Rechteinhabern für die freundliche Überlassung der Abbildungen. Rechteinhaber, die wir nicht haben ausfindig machen können, mögen sich bitte bei den Herausgebern melden.
© Rykov Bucharin, TASS, veränderte Größe, von lexikon-der-politischen-strafprozesse.de, CC0 1.0
© Bukharin with news reporters, Photo by Samsonov, veränderte Größe von lexikon-der-politischen-strafprozesse.de, CC0 1.0