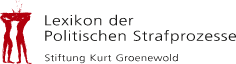Norwegen 2011
Spengstoffattentat, Mord
Anschläge von Oslo und Utøya 2011
Rechtsextremismus
Der Prozess gegen Anders Behring Breivik
Norwegen 2012
Ich meine, Anders hat ein gründliches und faires Urteil bekommen. Er hat die Strafe bekommen, die er verdient. Selbst die schlimmsten Verbrecher haben das Recht auf einen korrekten Prozess. Quisling bekam ihn. Rinnan bekam ihn. Selbst ein Mann wie mein Sohn hat ihn bekommen – einen Prozess in einer Gesellschaft, der er sich eigentlich verweigerte. Obwohl er das Beste in unserer Gesellschaft angriff und das Schlimmste in die Tat umsetzte. Es sagt viel über die Gesellschaft aus, die er angriff, wie die Rechtssache angelegt war. Hatte er wirklich geglaubt, dass er gefoltert werden würde, wie er behauptete? Woher hatte er diese Gedanken?
Anders kann nicht verstanden haben, in welcher Gesellschaft er lebte.
Jetzt weiß er es.
Jens Breivik: Min skyld? En fars historie. Oslo 2014.
1. Prozessgeschichte/Prozessbedeutung
Mit dem Prozess gegen Anders Behring Breivik wurde Rechts- und Politikgeschichte geschrieben, er dürfte neben dem gegen Vidkun Quisling (1887–1945), gegen den Gestapo-Agenten Henry Rinnan (1915–1947) – beide wurden zum Tode verurteilt und hingerichtet – und dem gegen Knut Hamsun (1859–1952) der wichtigste in Norwegen überhaupt sein. Dies nicht nur wegen der zur Last gelegten Straftaten, sondern auch wegen des Prozessverfahrens und der Herstellung einer nationsweiten Öffentlichkeit. Gerade dieser Punkt macht ihn so interessant im internationalen Vergleich – ein Jahr später fand in München der NSU-Prozess unter ganz anderen Bedingungen statt; der Prozess gegen den Halle-Attentäter 2020 lädt ebenfalls zum Vergleich ein. Der Breivik-Prozess wurde am 16. April 2012 vor dem Osloer Bezirksgericht (Oslo Tingrett) eröffnet, neun Monate nach dem Attentat in Oslo und dem Massaker auf Utøya vom 22. Juli 2011. Die Anklage lautete auf Terrorismus und Mord in besonders schweren Fällen. Nach zehn Wochen und 43 Verhandlungstagen wurde das Urteil am 24. August gesprochen, einstimmig von den beiden Berufs- und drei Laienrichtern: 21 Jahre Haft und anschließende Sicherungsverwahrung – in Norwegen die Höchststrafe, es ist davon auszugehen, dass er nie wieder in Freiheit gelangen wird. Der Name Anders Behring Breivik ist durch seine Taten und den Prozess im nationalen Gedächtnis Norwegens eingeätzt – das war auch seine Intention.
Die Terroranschläge
Breivik hatte am Freitag, 22. Juli 2011 um 15:25 Uhr im Osloer Regierungsbezirk eine 950 Kilogramm schwere Autobombe gezündet, die er aus Ammoniumnitrat und Dieselöl selbst hergestellt hatte. Einige Stunden zuvor hatte er ein Video ins Netz gestellt, in dem er seine Tat ankündigte und sich selbst als „Kommandeur“ der „Tempelritter“ vorstellte – eine Organisation, die er erfunden hatte. Minuten vor der Zündung schickte er ein 1.500 Seiten langes „Manifest“ an 1.003 E‑Mail-Adressen, mit dem er seine bevorstehenden Taten begründete: „2083. A European Declaration of Independence“. Der Kleinlaster mit der Bombe wurde „atomisiert“, an seiner Stelle klaffte ein zwei Etagen tiefer Krater (Borchgrevink, 2015). Acht Menschen kamen zu Tode, neun wurden schwer verletzt; etwa 500 Personen befanden sich im näheren Umfeld der Explosion und erlitten physischen und psychischen Schaden (so im Urteil). Alle Gebäude der näheren Umgebung wurden beschädigt, das Osloer Regierungsviertel praktisch zerstört, das 16-stöckige Hauptgebäude mit dem Justizministerium und der Staatskanzlei wurde unbrauchbar, im Energieministerium brach Feuer aus. Der auf der Todesliste ganz oben vermerkte Ministerpräsident Jens Stoltenberg befand sich nicht in seinem Büro, sondern in seiner Dienstwohnung und bereitete mit Mitarbeitern die Rede vor, die er am nächsten Tag auf der Insel Utøya halten wollte; um 15:51 Uhr wurde die Nachricht verbreitet, dass er am Leben sei und sich „an einer geheimen Stelle aufhalte“; so gut wie alle Regierungsmitglieder befanden sich im Urlaub, waren nicht in Oslo (Stormark, 2011; Solvoll, Malmø, 2011). Bereits beim ersten Verhör, nur wenige Stunden nach dem Attentat, zeigte Breivik sich enttäuscht, dass die Zerstörungen nicht umfänglicher ausgefallen waren, die Zahl der Opfer nicht höher. (Nach Jahren ist die Neuplanung des Regierungsviertels abgeschlossen, die ersten Ministerien sind abgerissen, 2023 soll mit den Um- und Neubauten begonnen werden.)
Anschließend fuhr er zum 38 Kilometer entfernten Tyrifjord und setzte, jetzt in Polizei-Uniform, gegen 17 Uhr auf die Insel Utøya über, dort fand das traditionelle Sommercamp der sozialistischen Arbeiterjugend statt. Mit der Begründung, er wolle die Jugendlichen über das Bombenattentat in Oslo informieren, rief er diese zusammen und begann um 17:21 Uhr ohne Vorwarnung auf sie zu schießen: 67 Personen verloren das Leben zumeist durch Kopfschüsse, eine ertrank, eine stürzte von den Klippen in den Tod, 33 wurden zum Teil schwer verletzt. Auf der Insel befanden sich 530 Personen zwischen 14 und 51 Jahren: Zwei der Todesopfer waren 14 Jahre alt, sieben 15 Jahre, acht 16 Jahre, 16 Opfer waren 17 Jahre, 17 Opfer 18 Jahre alt, mithin waren 50 der 67 Opfer unter 18 Jahre alt (Solvoll, Malmø, 2011). Anwesende Politiker, mit denen er rechnete, wollte er verhaften und sie zwingen, ihr Urteil zu verlesen, um sie anschließend mit dem Bajonett hinzurichten. Genau wie der Ministerpräsident entging Gro Harlem Brundtland dem Attentat. Die dreifache Ministerpräsidentin und Mitverfasserin des Brundtland-Berichtes „Unsere gemeinsame Zukunft“ von 1987 stand auf Breiviks Mordliste. Aber er kam zu spät, sie war nach ihrem Vortrag um 14:50 Uhr vorzeitig abgereist (Stormark, 2011, listet die Ereignisse von Minute zu Minute auf). Seine „Aktionen“ waren auf die Führungsriege der Sozialdemokraten und andere aktive Politiker gerichtet (Platz 1), dann auf die „Helfer“ in Presse und Organisationen (Platz 2), an dritter Stelle rangierten die Kinder der ersten und zweiten Kategorie (Lippestad, S. 53f.).
Breivik hat rund 75 Minuten wahllos gemordet. Als die Anti-Terroreinheit gegen 18:35 Uhr eintraf, ließ er sich widerstandslos mit den Worten festnehmen: „Das ist nur der Anfang. Der Bürgerkrieg hat gerade erst begonnen. Ich will den Islam nicht in Europa haben, und meine Partisanen teilen meine Ansichten. Wir wollen nicht, dass Oslo wie Marseille endet, wo Muslime seit 2010 in der Mehrzahl sind. Wir wollen für Oslo kämpfen. Meine Operation ist zu hundert Prozent gelungen, weshalb ich mich jetzt ergebe. Aber die Operation an sich ist nicht wichtig. Das war nur das Feuerwerk“ (zit. nach Seierstad, 2013; Solvoll, Malmø, 2011; die Abläufe werden im Urteil ausführlich nachgezeichnet, Oslo Tingrett, 2012).
Die ersten Anrufe von der Insel gingen wenige Minuten nach den ersten Schüssen bei der Polizei ein; es dauerte eine Stunde, bis das Einsatzkommando am Tatort eintraf – was zum einen der Insellage geschuldet war, zum anderen polizeilichen Kommunikationsproblemen, schließlich verfügte die Polizei über keine einsatzfähigen Hubschrauber (alle Polizei-Hubschrauberpiloten waren im Urlaub), sie musste mit Booten übersetzen, bei denen es zudem Motorenprobleme gab. – Ein deutscher Tourist vom gegenüberliegenden Campingplatz zog 25 bis 30 Überlebende aus dem Wasser und brachte sie mit seinem gemieteten Boot in Sicherheit, er wurde als Held gefeiert. – Eine Untersuchungskommission, bereits im August eingesetzt, hat genau ein Jahr später die Mängel und Versäumnisse in einem fast 500 Seiten starken Bericht dokumentiert (NOU 2012:14). Der kritisierte norwegische Polizeichef trat im August 2012 auch wegen mangelnder politischer Unterstützung zurück, sein Amt hatte er kurz vor den Attentaten angetreten (2013 wurde er Chef der Gesundheitsbehörde).
Norwegen stand unter Schock, die landesweite Trauer schloss alle politischen Lager und Schichten ein, die Schweigeminuten und die Gedenkveranstaltungen danach wurden zu überwältigenden nationalen Gemeinschaftsbekundungen: Am Sonntag fand im Osloer Dom ein Gedenkgottesdienst statt, die Königsfamilie war anwesend, der Regierungschef und mehrere Kabinettsmitglieder; die Bilder des weinenden Königs und des Blumenmeeres vor der Kirche gingen um die Welt; am folgende Montag sollte ein „Rosenzug“ durch die Innenstadt von Oslo stattfinden – allein die Masse der Versammelten machte einen „Zug“ unmöglich: 200.000 Menschen waren vor dem Rathaus zusammengekommen, die größte Menschenmenge seit Ende des Zweiten Weltkrieges, in so gut wie allen Städten Norwegens ereignete sich Vergleichbares. Jens Stoltenberg war unter den Sargträgern bei der Beerdigung der 45-jährigen Monica Elisabeth Bøsei am 5. August, sie war viele Jahre die Leiterin der Camps auf der Insel gewesen und wurde „die Mutter von Utøya“ genannt (Solvoll, Malmø, 2011). Eine besondere Demonstration von Gemeinschaft ereignete sich zehn Tage nach Prozessbeginn: Im April 2012 versammelten sich die Menschen landesweit, in Oslo waren es ca. 40.000 auf dem Young-Platz. Sie protestierten gegen das Auftreten des Attentäters und sangen das von Pete Seeger entliehene „My Rainbow Race“: Die norwegische Fassung („Kinder des Regenbogens“) gehört zum allgemeinen Erziehungsgut und war von Breivik als marxistische Gehirnwäsche etikettiert worden; der Refrain lautet: „Gemeinsam werde wir leben, jede Schwester, jeder Bruder, kleine Kinder des Regenbogens…“ (Der Standard); danach bewegte sich die Menschenmenge in Richtung Gerichtsgebäude.
„22/7“ wurde zum norwegischen „9/11“. Die Welt nahm Anteil und trauerte mit. In ganz Nordeuropa wurden die Fahnen auf Halbmast gesetzt, in Dänemark nahm Königin Margrethe an einem Trauergottesdienst teil, in Stockholm die Kronprinzessin, Präsident Obama kondolierte und trug sich in das Kondolenzbuch der norwegischen Botschaft in Washington ein (Solvoll, Malmø, 2011). Der türkische Außenminister war zur Beisetzung der 17-jährigen Gizem Dogan am 1. August in Trondheim angereist.
Warum Utøya?
Die etwa elf Hektar große, 520 Meter lange und 350 Meter breite Insel, 500 Meter vom gegenüberliegenden Ufer entfernt und nur mit einem Boot zu erreichen, wurde durch das Massaker vom 22. Juli 2011 zu einem besonderen norwegischen Erinnerungsort. Sie war dies aber schon lange davor, was auch der Grund war, weshalb Breivik sie ausgewählt hatte: Sie ist der norwegische Inbegriff sozialdemokratisch-sozialistischer Politiksozialisation, sie steht für linke, für multikulturelle Politik, sie ist der Sehnsuchtsort der norwegischen Sozialdemokratie. Jahr für Jahr fanden (und finden) hier die Sommerlager der Parteijugend statt, politische Seminare werden veranstaltet, führende linke Politikerinnen und Politiker besuchen die Versammlungen, auf der Insel wurden Ehen und lebenslange politische Freundschaften gestiftet, politische Karrieren begründet, wohl kein führender Politiker der Arbeiterpartei ist im Laufe seiner Sozialisation nicht in einem der Sommerlager gewesen. Die Insel gehört zur DNA der Partei. Die Landschulheim-Atmosphäre mit Tanz, Gesang und Grillabenden hinterließen nachhaltige Heimat-Gefühle.
Die Insel kam Anfang der dreißiger Jahre aus Privatbesitz ins Eigentum der Gemeinde Oslo, dann 1950 in das der Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF), der Jugendorganisation der sozialdemokratischen Arbeiterpartei Norwegens.
Anfangs und während des Krieges fanden hier sechswöchige Erholungs-Sommerlager für bedürftige Kinder statt; die Widerstandsbewegung nutzte sie während der deutschen Besetzung Norwegens, aber auch die norwegische Nazipartei versuchte sich auf dem Eiland.
In den Annalen ist ein mehrwöchiger Aufenthalt Leo Trotzkis vermerkt, der hier 1936 während seines norwegischen Exils letzte Hand an seine „Die verratene Revolution“ legte, im Dezember wurde er gegen seinen Willen auf ein Schiff mit Ziel Mexiko verfrachtet, wo er 1940 von einem Sowjetagenten auf Geheiß Stalins ermordet wurde. Aber auch für die internationale Verständigung spielte die Insel eine Rolle: Spanische Flüchtlinge kamen in den fünfziger Jahren, chilenische nach dem Pinochet-Putsch ebenso. In den frühen siebziger Jahren etablierte sich eine zwei Jahrzehnte dauernde Besuchstradition mit der „Sozialistischen Jugend Deutschlands – die Falken“.
2. Personen
a. Der Angeklagte
Anders Behring Breivik wurde am 13. Februar 1979 in Oslo geboren; der Vater, Jens David Breivik, stand zu dem Zeitpunkt im auswärtigen diplomatischen Dienst; die Mutter Wenche Behring, eine Krankenschwester, brachte eine sechs Jahre ältere Tochter in die Ehe. Kurz nach der Heirat zog die Familie nach London. Die 1977 geschlossene Ehe scheiterte 1980, die Mutter zog mit dem Sohn nach Oslo; Anfang 1983 erfolgte die Scheidung. Der Vater hielt über die Jahre nur losen Kontakt mit seinem Sohn, 1983 ging er nach Paris, war auf Posten im Auswärtigen Dienst und lebt seit seiner Pensionierung in Südfrankreich (Breivik, 2014; Süddeutsche Zeitung, 2015). Die Mutter wandte sich bereits 1981 an die Sozialbehörden, sie war offenbar mit der Rolle als Alleinerziehende eines schwierigen Kindes überfordert; in den Begutachtungen wird sie als eine gestörte und desorientierte Person geschildert (vgl. Borchgrevink, 2012). 1983 wurden Mutter und Sohn für drei Wochen in einem Tagesheim aufgenommen, von einem Acht-Personen-Team betreut und begutachtet. Ein Psychiater schrieb an das Jugendamt: „Anders ist ein Kontakt abwehrendes, etwas ängstliches, passives Kind geworden, aber mit einer manisch geprägten Abwehr, mit rastloser Aktivität und einem gespielten, abwehrenden Lächeln (…). Es wird sehr wichtig sein, frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen, die einer ernstlichen Fehlentwicklung bei dem Jungen vorbeugen können.“ (zit. nach Borchgrevink, 2015; vgl. auch Olsen, 2016).
Ernsthafte Konsequenzen hatten die Empfehlungen von Jugendpflegern und ‑ämtern nicht. Als 15-jähriger gab es den ersten Kontakt mit der Polizei, als bei ihm zahlreiche Sprühdosen sichergestellt wurden und sich herausstellte, dass er zur Graffiti-Szene gehörte – auch dieses führte nicht zu Konsequenzen (Seierstad, 2013). Er besuchte ohne Abschluss das Osloer Handelsgymnasium und versuchte sich parallel und danach am Rande der Legalität im Marketinggeschäft, seine Firmeneinträge wurden gelöscht. Später stellte sich heraus, dass er ab 2002 etwa eine halbe Million Euro mit gefälschten amerikanischen akademischen Diplomen verdient hatte, andere Geschäfte und Spekulationen vernichteten dieses Kapital. 2006 zog er wieder bei seiner Mutter ein; der Konkursverwalter konstatierte 2008 Zuwiderhandlungen gegen Steuer‑, Aktien- und Bilanzrecht, weitere Ermittlungen gegen Breivik wurden eingestellt. 2009 ließ er die „Breivik Geofarm“ im Handelsregister eintragen, er wolle Gemüse, Melonen, Wurzel- und Knollengewächse anbauen, unter diesem Vorwand kaufte er insgesamt sechs Tonnen Ammoniumnitrat, einen Teil davon verwendete er für den Bau der Bombe; der Kauf war legal (Seierstad, 2013). Die Polizei fand bei der Untersuchung nach den Attentaten auf dem Anwesen weitere Sprengstoffvorräte, die er für eine noch größere Bombe vorgesehen hatte (Der Spiegel, 2011).
Anders Breivik gehörte von 1999 bis 2006 der rechtspopulistischen Fortschrittspartei (FrP) an (Jakobsen, 2015) und engagierte sich auf mehreren Ebenen, im Zuge seiner Radikalisierung wandte er sich jedoch von der Partei ab. Als sie 2013 zum ersten Mal Minister in eine (konservative) Regierung entsandte, geriet sie wegen Breiviks Mitgliedschaft in die internationalen Schlagzeilen; in Erklärungsnot betonte sie, eine liberalkonservative, liberalpopulistische Partei zu sein (nrk, 17.09.2013). Zu den vielen Organisationen, denen er sich, zumindest zeitweise, anschloss, gehörten die Freimaurer, die Johannis-Loge und ein Sportschützenverein; nach seinen Bekenntnissen will er u.a. für die islamfeindliche „English Defense League“ gearbeitet haben sowie für norwegische rechtsextreme Netzwerke – bei Nachprüfungen haben sich diese Angaben selten bestätigt.
Breivik bezieht sich auf die Konservative Revolution und argumentiert im Geiste einer selbstbezogenen, identitären Ideologie gegen den „Multikulturalismus“ und den „Kulturmarxismus“, in einem „Massenimport von Moslems“ sieht er eine Gefahr für Norwegen, Frauen sind ihm besondere Hassobjekte, Brundtland ist ihm eine „Landesmörderin“ (worin sich im Norwegischen ein Wortspiel versteckt: Landesmutter und Landesmörderin unterscheiden sich nur durch einen Buchstaben). Vor Gericht erklärte er: „Ich handelte im Auftrag meines Volkes, meiner Kultur, meiner Religion, meiner Stadt und meines Landes in Notwehr.“ Die Sozialdemokraten repräsentieren für ihn diese imaginierten Dekulturationen, der Massenmord an den jungen Aktivisten sollte mithin die nächste Generation mindestens schwächen, wenn nicht auslöschen. „Dem kulturellen Pluralismus Europas setzt er ein monokulturelles, (pseudo)christliches Kontrastbild entgegen.“ (Leggewie, 2016). Bezugspunkt ist immer die eigene Person: „mein“ Volk, „meine“ Kultur, „meine“ Religion, „meine“ Stadt, „mein“ Land.
Das auf Englisch verfasste „Manifest“ und das ins Netz gestellte Video nehmen, mit der Jahreszahl 2083 im Titel, Bezug auf die Schlacht am Kahlenberg 1683, als die zweite Belagerung Wiens und damit die Türken-Herrschaft auf dem Balkan beendet wurde, sowie auf das Ende des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges von 1783. Ziel der Anschläge und des „Templerordens“ sei der Kampf gegen „Multikulturalisten, Kulturmarxisten (…) und kapitalistische Globalisten“, wesentlich sind auch die Attacken gegen den „Feminismus“. Es geht ihm um die Begründung einer internationalen „al-Qaida für Christen“. Das Wenigste dieses Pamphletes ist von Breivik selbst, vielmehr handelt es sich um ein Konglomerat aus unterschiedlichen Quellen; seine wesentliche ist der norwegische Blogger „Fjordman“ (d.i. Peder N. Jensen), aber auch Islamkritiker aus einer Vielzahl von Ländern hat er kopiert (seine sogenannte „Unabhängigkeitserklärung“ ist als dreibändiges Taschenbuch erschienen, Breivik, 2011). Das Gericht ist auf wesentliche Punkte von „2083“ eingegangen, es führt auch biografische Details an (Oslo Tingrett, 2012). Es wäre eine – allerdings intendierte – Fehlinterpretation, Breivik mit diesem „Manifest“ eine wie auch immer geartete Intellektualität zuzusprechen, vielmehr handelt es sich um einen auf Selbstinszenierung basierenden geistigen Diebstahl: „Die Lektüre von 2083 ist eine wahre Qual.“ (Leggewie, 2016; zu „2083“ vgl. Borchgrevink, 2015).
b) Die Verteidiger
Bereits einen Tag nach dem Attentat beauftragte Breivik den Anwalt Geir Lippestad mit der Verteidigung. Dieser war auf Eigentumsrecht, Arbeitsrecht und Wirtschaftskriminalität spezialisiert und relativ unbekannt, seine Kanzlei sehr klein. Als Grund für seine Wahl gab Breivik an, dass er sich an ihn erinnert habe, da er vor Jahren im selben Gebäude ein Büro hatte, eine Zufallswahl. Als Sozialdemokrat war Lippestad jener offenen Gesellschaft zuzurechnen, die Breivik angriff – was der Anwalt als Grund für die Übernahme des Mandats nennt und dies auch beim ersten Treffen mit Breivik kommunizierte: „Wir haben in Norwegen eine Demokratie, für die das Rechtssystem sehr wichtig ist (…). Ich kann Ihre rechtlichen Interessen professionell wahrnehmen, auch wenn ich Ihre Tat verabscheue und Ihr Menschenbild gefährlich und wirklichkeitsfremd finde“ (Lippestad, S. 46). Im ersten norwegischen Rassenmordprozess 2002 hatte er aus diesen Gründen bereits den Täter verteidigt und sich eine Reputation als Anwalt eines Rechtsstaates erworben, dessen Grundwerte auch für Mörder gelten (Verdens Gang). Die beiden Anwälte aus seiner Kanzlei, Tord Eskild Kvinge Jordet und Odd Ivar Aursnes Grøn, ergänzten; als offensichtlich wurde, dass drei Personen die Aufgaben nicht würden bewältigen können, kam mit Vibeke Hein Bæra eine weitere Anwältin hinzu. Lippestad berichtet in seinem 2013 erschienen Buch (2015 auf Deutsch) sehr ausführlich über die Abstimmungsprozesse innerhalb des Teams und in der Konfrontation mit Breivik. Da dieser einen politischen Prozess führen wollte – was, wie die Anwälte ihm klarmachten, nach Lage der juristischen Dinge nicht funktionieren würde –, kam es zwischen ihnen zur Einigung auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner: Breivik verfolgt seine „politische“ Strategie, die Anwälte konzentrieren sich auf die rechtlichen Aspekte. Breivik: „Das ist völlig in Ordnung. Ich akzeptiere den sogenannten Rechtsstaat sowieso nicht, also kümmern Sie sich um das Recht. Verteidigen Sie mich so gut wie möglich. Ich will mich auf mein politisches Projekt konzentrieren“ (zit. nach Lippestad, S. 47).
Zur Hauptverhandlung waren weitere 165 Anwälte der Nebenkläger benannt, die allerdings nur für jeweils kurze Zeiten anwesend waren. Koordiniert wurden die das Regierungsviertel betreffenden Angelegenheiten der Nebenkläger von Siv Hallgren, von Frode Elgesem für Utøya und die AUF, ihnen war Mette Yvonne Larsen beigeordnet, diese drei nahmen an der gesamten Hauptverhandlung teil (nrk, 22.07.).
c) Das Gericht
Die Richterin am Osloer Bezirksgericht, Wenche Elizabeth Arntzen, führte den Vorsitz im Prozess. Ihre Reputation und insbesondere ihre Prozessführung sind und waren über jeden Zweifel erhaben. Amtsrichter Arne Lyng war der zweite Berufsrichter, auch er ein anerkannter und erfahrener Jurist. Daneben waren vier Laienrichter berufen: Ernst Henning Eielsen, Diana Patricia Fynbo, Ole Westerås und Anne Elisabeth Wisløff (nrk, 22.07.).
d) Gutachter
Die Psychiater Torgeir Husby und Synne Sørheim wurden mit der Anfertigung eines rechtspsychiatrischen Gutachtens beauftragt, das sie im November 2011 vorlegten – nach monatelangen Gesprächen mit Breivik, der Auswertung von Polizei-Videos von den Verhören und einem Interview mit der Mutter (Rettspsykiatrisk erklæring 1, 2011). Auf 243 Seiten attestieren die Verfasser ihm, dass er an paranoider Schizophrenie leide und nicht zurechnungsfähig sei. Eine unabhängige Rechtsmedizinische Kommission – diese Institution wird in Fällen wie diesen obligatorisch eingeschaltet – prüfte das Gutachten und bestätigte es. Die – auch internationale – Kritik an der Unzurechnungsfähigkeits-Diagnose war massiv, nicht zuletzt verwahrte auch Breivik selbst sich gegen die Diagnose, er war schlichtweg gekränkt darüber, nicht ernst genommen zu werden. Nachfolgend erklärte eine psychologisch-psychiatrische Arbeitsgruppe, die Breivik im Gefängnis betreute, dass er nicht psychotisch und nicht schizophren sei, dass keine Selbstmordabsichten bestünden und dass er medizinisch nicht betreut werden müsse.
Das Gericht bestellte vor diesem Hintergrund erwartungsgemäß ein zweites Gutachten, das die Psychiater Agnar Aspaas und Terje Tørrissen wenige Tage vor Prozessbeginn vorlegten (Rettspsykiatrisk erklæring 2, 2012). Sie erklärten Breivik für zurechnungsfähig, er sei geistig gesund, habe eine narzisstische und antisoziale Persönlichkeitsstörung, psychotisch sei er nicht, also rechtlich für sein Tun zur Verantwortung zu ziehen. „Es besteht ein hohes Risiko für wiederholte Gewalttaten“ – Breivik wertete diese Aussage als Bestätigung seiner „politischen“ Intentionen. Die Rechtsmedizinische Kommission, die das erste Gutachten für korrekt erklärt hatte, stufte das zweite als ungenügend ein, es weise wesentliche Mängel auf. Diese Bewertung traf während des Prozesses ein, als Folge der Unstimmigkeiten wurden im Juni 2012 alle beteiligten Gutachter als Zeugen befragt, insgesamt 15 Fachleute.
Die Nebenkläger hatten einen weiteren Psychiater, Ulrik Malt, beauftragt, Breivik während des Prozesses zu beobachten. Bei seiner Vernehmung führte er aus, dass Breivik wohl am Asperger-Syndrom leide, auch das Tourette-Syndrom schloss er nicht aus. Von den vom Gericht befragten Medizinern und Psychologen hielten vier Breivik für unzurechnungsfähig, elf plädierten auf zurechnungsfähig. Bei einer Befragung norwegischer Psychiater und Psychologen hielten nur 14 Prozent Breivik für unzurechnungsfähig. Das Agieren der Rechtsmedizinischen Kommission wurde im Laufe des Prozesses öffentlich heftig kritisiert, ihr Befangenheit und Unprofessionalität vorgeworfen. Es hat in der norwegischen Rechtsgeschichte keinen Fall von so widerstreitenden Bewertungen gegeben, was auch auf die Unerfahrenheit norwegischer Gerichte und Sachverständigen im Umgang mit politischem Terrorismus zurückgeführt wurde. Im Nachgang zum Prozess sind ausgreifende Debatten über den Sinn, die Zusammensetzung und die Arbeitsweise der Kommission geführt worden, eine Reihe von Gesetzesänderungen passierten das Parlament (s.u.).
3. Zeitgeschichtliche Einordnung
Jens Stoltenberg, der Ministerpräsident und Repräsentant jener Bewegung, die, auch wenn sie nicht regiert, in Norwegen eine staatstragende Rolle hat – die Sozialdemokratie (der Begriff „Arbeiterpartei“ ist in Norwegen der gebräuchliche) –, dessen Jugend Anders Behring Breivik mit seinem Massaker ausrotten wollte, Jens Stoltenberg hat gleich nach dem Attentat festgehalten und dieses beständig wiederholt, dass die norwegische Gesellschaft nicht von ihren demokratischen und ethischen Werten lassen solle. National wie international ist anerkannt worden, dass er den Zusammenhalt der Nation nicht nur beschworen, sondern in der Krisensituation mit seinem Reden und Handeln auch gestärkt hat. Kaum eine Gemeinde in Norwegen, die nicht von den Attentaten im buchstäblichen Sinne getroffen war; die in ihre Heimatorte zurückkehrenden Überlebenden und Verletzten brachten eine Zeugenschaft mit, die es zu be- und verarbeiten galt. Der Ministerpräsident füllte die Rolle einer „einigenden nationalen Symbolgestalt“ aus: „Er hat die Nation zusammengehalten.“ Seine Wertehaltung wurde die allgemeine: „Die Prinzipien von Solidarität und Anständigkeit müssen unseren Weg weiter leiten“ (Bugge, 2015; Johansen, 2015). Bei der Trauerfeier im Osloer Dom hatte er hinzugefügt, dass die Antwort auf den Terror doch „niemals Naivität sein könne“ (Seierstad, 2013). Die Frage nach den Werten einer Demokratie spielte auch für die Verteidiger und in der öffentlichen Diskussion eine große Rolle, es ging um die Übernahme von Verantwortung. Geir Lippestads Buch ist durchzogen von den Reflexionen über die eine Gesellschaft zusammenhaltenden Werte und Normen – die Anwälte schließlich waren über die gesamte Prozessdauer (und auch danach) von nicht nur rechtsextremistischen Verfolgungen ausgesetzt und mit Morddrohungen konfrontiert; sie berichten auch von medialen Nachstellungen (Lippestad).
4. Anklage
Die Staatsanwälte Inga Bejer Engh und Svein Holden klagten Breivik wegen Terrorismus und mehrfachem vorsätzlichen Mord an. Zur Frage der Schuldfähigkeit schlossen sie sich der Unzurechnungsfähigkeits-Diagnose des ersten rechtspsychiatrischen Gutachtens an; sie hielten es für „schlimmer, einen psychotischen Menschen irrtümlich in Haft zu nehmen, als einen nicht-psychotischen in eine Zwangspsychiatrie“. Zwar kritisierten sie das erste Gutachten in einigen Punkten und zeigten sich „nicht überzeugt“, dass bei ihm eine Psychose vorliege, sondern erklärten ihre Zweifel – die aber dem Angeklagten anzurechnen seien.
5. Verteidigung
Bei der Vorführung vor dem Haftrichter am Montag nach dem Attentat bekannte Breivik sich zu den Taten, die „grausam, aber notwendig“ gewesen seien, strafschuldig sei er aber nicht: Er wollte der Arbeiterpartei „größtmöglichen Schaden“ zufügen, denn sie sei für die „Kolonisierung durch Moslems“ verantwortlich; Unterstützer habe er für seine Ideologie, es habe aber keine Mittäter gegeben, die Taten habe er alleine ausgeführt. Wie erwähnt, wurden vom Angeklagten und seiner Verteidigung zwei unterschiedliche Strategien verfolgt (zum Folgenden Lippestad): Breivik bestand darauf, den Prozess zu einem politischen zu machen, zu einer Anklage der Personen und Institutionen, die er für verantwortlich für die Islamisierung Norwegens und den Multikulturalismus hält; demgegenüber blieben die Anwälte bei der wertebasierten juristischen Strategie, wie sie nach Gesetzeslage und Prozessordnung vorgesehen ist, Breivik ist für seine eigenen Verbrechen angeklagt, nicht die der anderen. Auch das Gericht und die Anklage verfuhren nach dieser Regel, Breivik sollte keine Sonderbehandlung erfahren – dass der Fall wie jede andere Strafsache verhandelt wurde, hat in der Öffentlichkeit viel Kritik provoziert. Lippestad verwahrte sich dagegen, dass er des „Teufels Advokat“ sei, diese Begrifflichkeit gehöre weder zu seiner Terminologie noch zu seinem Menschenbild. Dass Breivik am ersten Verhandlungstag von allen Beteiligten mit Handschlag begrüßt wurde – Verteidigung und Anklage –, ist weltweit kritisiert worden, gehöre aber, so Lippestad, zur norwegischen Gerichtspraxis; Lippestads Reaktion: Das ist bei uns so üblich. Die Kritik an der Verteidigung und ihren Grundsätzen ließ nach, als sie Zustimmung aus der Presse bekam: „Der schlimmste Verbrecher hat Anspruch auf den besten Verteidiger“ (zit. nach Lippestad, S. 80).
Die Frage der Zurechnungsfähigkeit war anfangs für Breivik eine irrelevante, er zielte auf eine Anklage der aus seiner Sicht verantwortlichen Personen, damit die Anerkennung seiner „politischen“ Ansichten. Die Verteidigung beschloss im Frühherbst, die Verteidigungsstrategie auf der „Annahme der strafrechtlichen Unzurechnungsfähigkeit aufzubauen“ (Lippestad, S. 123). Erst nachdem die erste Gutachterrunde Breivik Unzurechnungsfähigkeit attestierte, wurde das Thema für ihn ein zentrales, wie bereits angedeutet – er wolle als politischer Aktivist ernst genommen und nicht für geistesgestört gehalten werden, das wäre schlimmer als der Tod; die Diagnose würde seiner politischen Absicht zuwiderlaufen, und auch Lippestad kamen Zweifel, wie man „eine Kombination aus Schwerkriminalität und schierem Wahnsinn“ strafrechtlich in Übereinstimmung bringen könne. Breivik blieb über die Prozessdauer (und auch danach) bei seinem Geständnis, plädierte, unter Berufung auf ein „Notrecht“, auf „nicht schuldig“; sein Motiv sei die Verhinderung eines Bürgerkrieges gewesen, er habe „aus Güte, nicht aus Boshaftigkeit“ agiert. Er verlangte nach einer unabhängigen Kommission von Politikwissenschaftlern und ‑experten, von Fachleuten für Terror und Gewalt, eine weitere Untersuchung durch Psychiater und Psychologen lehnte er aber ab. Jedem in Norwegen war klar, welche weitreichenden Konsequenzen die Diagnose der Unzurechnungsfähigkeit nach sich ziehen würde, lag doch die Parallele zu Knut Hamsun aus den Nachkriegsprozessen gegen Landesverräter und Kriegsverbrecher nahe – und der Einweisung des Nobelpreisträgers in die Psychiatrie.
Die Verteidigung vollzog die Wende und verfolgte nun die Strategie der Zurechnungsfähigkeit. Breiviks Strategie der Politisierung des Prozesses gipfelte in seinem Verlangen, mehr als 100 Personen als Zeugen zu laden, zumeist Politikerinnen und Politiker, „Multikulturalisten“; er berief sich auf den „Kulturkampf“ des „Nationalsozialistischen Untergrund“ (NSU); norwegische Neonazis sagten im Prozess als Zeugen aus, dass Norwegen sich „im Krieg befände“, die „Balkanisierung“ bevorstünde. „Nicht schuldig“ wurde von der Verteidigung aufgenommen und aus formalen Gründen auf Freispruch plädiert, da eben dieses Breiviks Überzeugung sei, zugleich aber stimmte Lippestad mit der Staatsanwaltschaft überein, dass Breiviks „Terrorhandlung von kaum vorstellbarer Bösartigkeit“ sei und nannte ihn einen „Terroristen“.
Auf die Aussagen der Mutter verzichtete das Gericht aus gesundheitlichen Gründen; aus dem ersten Gutachten der beiden psychiatrischen Experten wurde verlesen, die Schweigepflicht des Kinderpsychiaters Per Olav Næss, der 1983 die Familie beobachtet hatte, wurde nicht aufgehoben.
6. Urteil und Urteilsbegründung
Am 24. August 2012, dem Tag der Urteilsverkündung, betrat Breivik den Gerichtssaal mit großer Geste: Anzug, Hemd mit Krawatte, die Hände in Handschellen, aber erhoben zum Hitler-Gruß – wie auch am ersten Tag des Prozesses; seine Gesichtszüge während des Prozessgeschehens sind von der Berichterstattung immer wieder als „Grinsen“ beschrieben worden. Die Vorsitzende Richterin verlas die 106 Seiten von 10 Uhr an bis in den späten Nachmittag, das nationale Fernsehen übertrug in voller Länge. Dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die Breivik in Übereinstimmung mit dem ersten psychiatrischen Gutachten für unzurechnungsfähig erklärt hatte, folgte das Gericht nicht, es verhängte dementsprechend aufgrund der Schwere der Tat eine Haft von 21 Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung wegen Mordes an 77 Menschen. Dies bedeutet, dass Breivik nie wieder in Freiheit kommt – die Schuldfähigkeit ist Voraussetzung für eine Strafbarkeit, in Norwegen, wie auch in Deutschland. Ausführlich wird auf die Taten eingegangen, wird jedes einzelne Opfer gelistet, werden die Todesursachen und die Verletzungen genannt. Ebenfalls ausführlich geht das Urteil auf die psychosoziale und intellektuelle Entwicklung Breiviks ein, schließlich auch auf die Genese seines Welt‑, besser Feindbildes. Der Verlesung aus den Vernehmungsprotokollen, denen zufolge Breivik sich nach einem Staatsstreich und der Machtübernahme als neuer Regent Sigurd Kreuzfahrer II. nennen wolle (Tingrett, 2012), das Urteil nahm er mit offensichtlicher Genugtuung zur Kenntnis.
Die kontroversen psychiatrischen Gutachten und die auch vor Gericht diskutierten Kontroversen über die Frage seiner Zurechnungsfähigkeit werden im Urteil detailliert gewürdigt. Die Richterinnen und Richter analysierten auf der Grundlage einschlägiger juristischer und psychiatrischer Fachliteratur die Widersprüche und die auch im Fach unterschiedliche Auslegung international festgelegter Normen zur psychischen Krankheit/Gesundheit. Sie zitieren ausführlich aus der Fachliteratur, aus früheren Jugendamts-Berichten und aus den beiden psychiatrischen Gutachten: „Zurechnungsfähigkeit“ ist ein Kapitel des Urteils überschrieben, worin sie sich mit den juristischen Implikationen auseinandersetzen, aber vor allem mit den Erscheinungsbildern von Psychose, paranoider Schizophrenie und paranoider Psychose. Dass Breiviks Denken und Handeln (auch) politisch-ideologisch einzusortieren sei, wurde im ersten Gutachten nicht bedacht – das Urteil spricht dies an –, im zweiten aber sehr wohl: „Das Gericht ist bestürzt über die wortreiche Darstellung seiner fanatischen rechtsextremistischen Einstellung, durchsetzt von prätentiösen historischen Parallelen und einer infantilen Symbolik. Seine Gedanken sind durchsetzt von einer ungehemmten und zynischen Rechtfertigung von Gewalthandlungen, die ‚grausam, aber notwendig‘ seien (…). Wie in vielen Zeugenaussagen der Sachverständigen hingewiesen wurde, gehören Gewaltverherrlichungen oder extreme Gewalttaten nicht unter die diagnostischen ICD-10-Kriterien für Psychose.“ Nach Meinung des Gerichts liegt es außerhalb der Beweisführungspflicht, inwieweit die „grauenvollen Taten“ des Angeklagten „tiefere psychologische Ursachen“ haben. „Das Gericht geht jedenfalls davon aus, dass die Befähigung des Angeklagten, die ausgeführten Straftaten teilweise aus einer Mischung von fanatischer rechtsextremistischer Ideologie, der Einnahme von leistungssteigernden Medikamenten und möglicher Selbstsuggestion in Kombination mit pathologischen oder abweichenden Zügen seiner Persönlichkeit erklärt werden können“ (Tingrett, 2012).
Die norwegische „Verwahrungsstrafe“ kennt kein Entlassungsdatum, sie kann während der Haft immer wieder verlängert werden und ist deswegen nicht mit der deutschen „Sicherheitsverwahrung“ zu vergleichen. Breivik wurde zur Verwahrung verurteilt, weil er als eine Gefahr für die Gesellschaft betrachtet wurde und die höchste Freiheitsstrafe von 21 Jahren nicht ausreichend wäre, um die Bevölkerung vor ihm zu schützen. Die Mindestzeit der „Verwahrung“ sind zehn Jahre, danach kann eine Probeentlassung beantragt werden (im September 2020 hat Breivik einen solchen Antrag gestellt (nrk, 16.09.2020)). Nach Ablauf der zehn Jahre und vor Ablauf der 21 Jahre, zu denen er ja verurteilt worden ist, könnte er theoretisch entlassen werden, falls das Bezirksgericht feststellen sollte, dass Breivik sich geändert habe, sodass er nicht mehr die Bedingungen für die Bewährungsstrafe erfüllt (z.B. Gefahr für die Gesellschaft, Wiederholungsgefahr). Sollte er nicht entlassen werden, kann der Staatsanwalt kurz vor Ablauf der 21 Jahren eine Verlängerung um fünf Jahre beantragen, die dann wieder vor dem Ablauf wieder und wieder verlängert werden kann. Seine Strafe wird im letzten Ende lebenslänglich.
Die Staatsanwaltschaft verzichtete auf Berufung mit dem Hinweis: „Es war uns wichtig, dass die Angehörigen der Toten einen schnellen Abschluss dieses Verfahrens bekommen.“ Auf Nachfrage des Gerichts antwortete Breivik: „Ich erkenne das Gericht als Vertreter des Multikulturalismus nicht an und kann mich auch deshalb nicht zu dem Urteil äußern.“ Im Namen des Angeklagten verzichtete Breiviks Verteidiger auf Rechtsmittel, das Urteil wurde damit am 7. September 2012 rechtskräftig (Oslo Tingrett, 2012).
Hätte das Gericht ihn für nichtzurechnungsfähig erklärt, und wäre er einer psychologischen Behandlung unterworfen worden, wie dies von Gutachtern befürwortet worden war, dann wäre dies in Breiviks Augen die größte Kränkung seines an Kränkungen reichen Lebens geworden. Nach der norwegischen Rechtsordnung hätte er dann im Falle einer erfolgreichen Behandlung, das heißt also der psychischen Wiederherstellung, aus der Verwahrung entlassen werden müssen – seine Taten würden als die eines Kranken gewertet, den man nicht für sein Tun verantwortlich machen und bestrafen kann. Das Gericht ist dieser Interpretation nicht gefolgt, er hat dieses Urteil gewollt und daher auf eine Revision verzichtet.
Jedem, der seine Reaktion bei der Urteilsverkündung erlebt hat oder ihr auf dem Bildschirm folgte, werden die triumphalen Gesten im Gedächtnis bleiben, mit denen er die richterliche Zurechnungsfähigkeitserklärung und das Urteil quittierte – es war für ihn eine Genugtuung. Breivik hat während der Verhöre und während des ganzen Prozesses kein Mitleid für die Opfer und die Hinterbliebenen gezeigt. Emotional wurde er nur – lässt man sein beständiges Grinsen außer Betracht – als eine von ihm selbst verfertigte Präsentation über sein Programm im Gerichtssaal gezeigt wurde, darüber, dass nicht mehr Menschen bei der Bombenexplosion getötet worden waren (er wollte das ganze Regierungsviertel in Schutt und Asche legen, fantasierte von tausenden von Opfern) und dass er nicht mehr Menschen auf der Insel erschossen hat, sein Ziel war gewesen, alle Teilnehmer des Camps hinzurichten. Berührt war er über das in seinen Augen korrekte Urteil.
7. Wirkung und Wirkungsgeschichte
Als Konsequenz der Terrortaten hat das norwegische Parlament noch im Verlauf des Prozesses und als Folge der Unstimmigkeiten über die erste psychiatrische Expertise die Regeln im Rahmen der Begutachtung im Gesundheitswesen präzisiert, insbesondre für den Umgang mit psychisch Erkrankten, als „Lex Breivik“ diskutiert. In den Folgejahren wurden eine Reihe von Anhörungen zum Gesundheitswesen durchgeführt und Änderungen beschlossen.
Unter den politischen Parteien Norwegens gab es eine Debatte darüber, wie man mit dem Massaker politisch umgehen solle – vor dem Hintergrund, dass sechs Wochen danach Kommunalwahlen stattfinden würden, dass Breivik es ausschließlich auf die sozialistische Jugend abgesehen und dass er eine Vergangenheit mit der rechtspopulistischen Fortschrittspartei gehabt hatte. Es hätte nahegelegen, das Attentat politisch zu instrumentalisieren, insbesondere für die Arbeiterpartei – alle Parteien entschieden aber, dieses nicht zu tun; Jens Stoltenberg trat in den Wahlkämpfen als Landesvater auf und nicht als Repräsentant einer politischen Bewegung, die fast eine ganze Nachwuchsgeneration verloren hatte: Die Partei der Opfer gewann Stimmen bei der Kommunalwahl 2011, sie musste aber erhebliche Verluste bei den Stortingswahlen im September 2013 hinnehmen und verlor die Regierungsmacht, eine konservativ geführte Regierung kam ins Amt, mit der Fortschrittspartei als Koalitionspartner. Kein Zweifel, es gab auch Stimmen, die sich für einen stärkeren ideologischen Reinigungsprozess eingesetzt haben, die das parteipolitische Beschweigen der sozialistischen Leiderfahrungen bedauerten.
Breivik führte sich bei den Verhören und auch vor Gericht wie ein „Narziss auf der Bühne“ auf (Seierstad, 2013). Seine Üb erheblichkeit blieb all die Jahre seither offensichtlich: Nach seiner Verhaftung und dann weiter nach seiner Verurteilung saß Breivik in einem Hochsicherheitsgefängnis ein, Kontakt zu anderen Häftlingen stand ihm nicht zu. Im November 2012 legte er Beschwerde gegenüber der Anstaltsleitung wegen „unmenschlicher“ Bedingungen ein; sein Anwalt stellte fest, dass sie gegen die Menschenrechte verstoßen. Aus der Haft schrieb er einen Brief an Beate Zschäpe, in dem er sie aufforderte, den NSU-Prozess zu einem politischen Tribunal umzufunktionieren. Der Brief wurde von den deutschen Stellen beschlagnahmt und nicht weitergeleitet (Auszüge sind im Netz einsehbar). Im Jahr darauf starb seine Mutter, auf deren Erbe er verzichtete, im August wurde er in ein anderes Gefängnis in der Provinz Telemark verlegt. Nach anfänglicher Ablehnung belegte er ab September 2013 ein politikwissenschaftliches Fernstudium an der Universität Oslo. 2016 legte er Klage ein gegen den norwegischen Staat wegen Verletzung der Menschenrechte, seine Isolierung und die Kontaktverbote seien Verstöße gegen die Regeln der Europäischen Menschenrechtskommission. In erster Instanz wurde ihm teilweise Recht gegeben. In zweiter Instanz im März 2017 wurden jedoch alle Klagen abgewiesen, der oberste Gerichtshof wies das Verlangen einer Berufung zurück; ebenso wenig war die Klage beim Europäischen Gerichtshof 2018 erfolgreich, gegen diesen Beschluss kann kein Einspruch eingelegt werden. Zu den Gerichtsterminen erschien Breivik kahlgeschoren und zeigte den Hitler-Gruß. Seit Juni 2017 nennt er sich Fjotolf Hansen.
Die Terrortaten Anders Behring Breiviks haben weltweit heftige Reaktionen hervorgerufen. Unzählbar sind die Bilder und Texte in diesbezüglichen sozialen Medien, nicht zuletzt auch während seines Auftretens vor Gericht; zu Prozessbeginn waren 800 Journalisten angereist, nationale und auswärtige. Länger als ein Jahr war er in den Schlagzeilen der Weltpresse, ihm war nationale und internationale Aufmerksamkeit sicher – dieser Teil seiner Strategie einer narzisstischen Aufmerksamkeitsweckung ging auf. Der Tag der Urteilsverkündung aber war sein letzter Tag des medialen Triumphs: Am Samstag, den 25. August 2012 dominierte er die Schlagzeilen der Weltpresse – am nächsten Tag war der Fall Breivik der Presse so gut wie keine Nachricht mehr wert; seine Erwartung, dass er mit Interviewanfragen überschüttet werden würde, erfüllte sich nicht; schließlich wies er Anfragen zurück oder ignorierte sie; auch seinem Vater verweigerte er einen Besuch (Seierstad, 2013, Breivik, 2014).
Die wissenschaftliche (und auch die künstlerische) Auf- und Bearbeitung war damit nicht zu Ende; nicht nur in Norwegen erschien seither eine Vielzahl von Publikationen zur Person, zur Tat und zum Rechtsextremismus. Für die norwegische Aufarbeitung spielte die Frage eine große Rolle, wie es sein konnte, dass „einer von uns“ zu einem Massenmörder wurde, nicht nur der internationale Bestseller von Åsne Seierstad nimmt diese Formulierung im Titel auf (in der deutschen Übersetzung): „Einer von uns: Die Geschichte des Massenmörders Anders Breivik“ (auch Enerstvedt, 2012). Bereits kurz nach dem Massaker machte das Wort mit ironischem Unterton die Runde: „ein norwegischer, hellhaariger Norweger aus Norwegen“ (Solvoll, Malmø, 2011).
Zu einer Kontroverse der besonderen Art kam es ab Ende 2011 – eine Kontroverse, in deren Zentrum eine Person mit internationaler Reputation stand, weshalb sie nicht nur national heftige Reaktionen provozierte, sondern auch in der internationalen Öffentlichkeit und Wissenschaft aufmerksam verfolgt wurde: Johan Galtung (geb. 1930), der „Gründungsvater der Friedens- und Konfliktforschung“ hatte im September an der Osloer Universität einen Vortrag mit anschließender Diskussion gehalten (gekürzt als „Zehn Thesen über den 22. Juli“, Galtung, 2011; Færseth, 2011; Søderlind, 2012; Nyfløt, 2012; Zondag, 2012), bei dem er insinuierte – und dieses mit weiteren Publikationen und Interviews vertiefte –, dass hinter Breiviks Taten die USA, die Freimaurer, der israelische Mossad und/oder das internationale Judentum stecken könnten; auch der Hinweis auf Goldman Sachs fehlte nicht. „Der Westen“, angeführt von den USA und Norwegen an der Seite, führe einen Krieg gegen den Islam, der 22. Juli habe Norwegen zum ersten Kriegsschauplatz gemacht: Breivik habe „mit kaltem Blut“ die Jungsozialisten erschossen, so wie norwegische Scharfschützen in Afghanistan Taliban, die einem „norwegischeren Afghanistan“ im Wege stünden, „wie Wild“ abschießen (Tandstad, 2012).
Er nennt eine Reihe von Quellen, um seiner Verschwörungstheorie Gewicht zu verleihen, u.a. verweist er auf Erik Rudstrøm (1920–2009), einen gelernten Radiotechniker, der mit einem zweibändigen Werk über die Freimaurer in Norwegen belegt haben will, dass die Arbeiterpartei ihre Richtlinien von den „Protokollen der Weisen von Zion“ bekommen habe; auf den Vorhalt, dass die „Protokolle“ bereits seit Jahrzehnten als Fälschungen identifiziert seien, möglicherweise vom zaristischen Geheimdienst verfasst, antwortete Galtung, er könne sich nicht vorstellen, dass der russische Geheimdienst in der Lage gewesen sei, eine solche Schrift zu verfassen, er empfahl seinem Publikum die Lektüre (Fritanke, 2012). Er verweist zudem auf einen schwedischen Forscher, der herausgefunden hat, dass der Einzug der Tempelritter in Jerusalem 1099, der Terroranschlag auf das Hotel King David 1946 und Breiviks Massaker am gleichen Datum stattgefunden haben, dem 22. Juli: „Zufall? Kaum.“ (Galtung, 2012). In den im Zusammenhang mit Galtungs Äußerungen publizierten Beiträgen von Journalisten, Holocaustforschern und Historikern ist die Rede von „einem intellektuellen und moralischen Selbstmord“, „Galtung spielt mit dem Feuer“, man müsse Galtung vor sich selbst schützen, schließlich auch, er habe endgültig den Verstand verloren; in der Haaretz erschien ein „offener Brief“ einer Friedensforscherin – „Peace-making and anti-semitism can’t go together“: „Your words have hurt people, they are unjust, and go against every principle of peace-making“ (Chaitin, 2012).
Zur Wirkungsgeschichte gehört aber auch die Verehrung des Massenmörders Breivik in den sogenannten sozialen Medien, er wurde zum Märtyrer verklärt und zu einer Kultfigur erhoben, die aktionistische Nachahmer fand – Breivik bediente diesen Kult aus dem Gefängnis. Die politische Verharmlosung, die Zahl der Nachahmungstäter, unter der Überschrift „der einsame Wolf“ ist beträchtlich, gescheiterte Versuche, missglückte und tragische: Beispielsweise erschoss am fünften Jahrestag des Utøya-Massakers 2016 ein 18 Jahre alter Attentäter im Münchner Olympia-Einkaufszentrum neun Personen und sich selbst, Breivik war sein Vorbild, die Umstände der Tat und die Netzeinträge weisen darauf hin, schließlich auch ging es beiden um die Tötung von jungen Menschen (sieben der Opfer in München waren Muslime). Auch der 29-jährige Attentäter im neuseeländischen Christchurch, der im März 2019 zwei Moscheen angriff und 51 Menschen tötete, war ein Nachahmungstäter (auch er wurde zu lebenslanger Haft ohne Chance auf eine vorzeitige Entlassung verurteilt). In Deutschland tat sich 2017 Jens Maier, Richter am Dresdner Landgericht hervor, der skurriler Weise insinuierte, Breivik sei aus „Verzweiflung heraus zum Massenmörder geworden“, die Einwanderung von „Kulturfremden“ wäre der Grund gewesen; Maier ist seit 2017 Bundestagsabgeordneter der AfD.
In Dänemark arrangierte Christian Lollike 2012 Teile von Breiviks Schrift „2083“ als einen Monolog, der in einem kleinen Theater in Kopenhagen präsentiert wurde, das Stück wurde auch in Oslo gezeigt, norwegische Hinterbliebene protestierten, Morddrohungen gingen ein. Am Deutschen Nationaltheater in Weimar sollten im Oktober 2012 ebenfalls Teile des Statements verlesen werden, die Veranstaltung wurde abgesagt, fand dann in einem Filmtheater statt, die Veranstaltung wurde am Ende des Monats auch in Berlin durchgeführt.
Im Herbst 2018 erschienen zwei Filme über das Attentat: Das ist die Netflix-Produktion des britischen Regisseurs Paul Greengrass mit einer Länge von 133 Minuten, Åsne Seierstad war als Drehbuchautorin beteiligt: „22. Juli“. Der zweite ist eine norwegische Produktion: „Utøya 22. Juli“ mit 92 Minuten Gesamtlänge; er schildert das Mordgeschehen auf der Insel aus der Perspektive einer fiktiven Person in einer einzigen, 72 Minuten langen Sequenz ohne Schnitt, mit der Handkamera gedreht – das war die Zeit, die Breivik auf der Insel mit seiner Aktion verbrachte. (Regie: Erik Poppe). Die Kritik bewertete beide Filme als herausragende und geglückte Beispiele, mit denen die Zuschauer nicht geschont werden, aber den Opfern und den traumatisierten Überlebenden ein „würdiges Denkmal“ gesetzt werde (Der Spiegel, 2018; General-Anzeiger, 2018).
In Oslo wurde 2019 ein Mahnmal („Jernrosene“) der Künstler Tobbe Malm und Tone Mørk Karlsrud eingeweiht, das mit 1.000 Eisenrosen an die Anschläge von Oslo und Utøya erinnern soll (Göttinger Tageblatt, 2019).
Über die Jahre kontrovers gestaltete sich die Debatte und die Entscheidungsfindung für ein geplantes Mahnmal auf oder gegenüber der Insel Utøya. Der Schwede Jonas Dahlberg legte zunächst die Idee zu einem Schnitt durch eine felsige Landzunge vis-à-vis der Insel vor, die Namen der Opfer sollten in eine der Wände eingraviert werden: „Memory Wound“; die Fertigstellung war für 2015, dann für 2017 anvisiert. Da das Projekt auf heftigen Protest der Anwohner stieß, die durch das Kunstwerk ständig an den schrecklichen Tag erinnert würden, scheiterte die Idee (Süddeutsche Zeitung, 2016). In einem zweiten Anlauf ist jetzt eine Gedenkstätte am Fähranleger gegenüber der Insel im Bau, die aus 77, je drei Meter hohen Bronzesäulen bestehen soll, mit einer Granittreppe ins Wasser; es wird eine neue Zufahrtsstraße geben und einen neuen Anleger für die Fähre. Der Protest der Anwohner ist nicht versiegt, sie prozessieren weiterhin gegen das Projekt; auf der anderen Seite verlangt die Organisation der Opfer und Hinterbliebenen nach einem Gedenkort (euronews 2021).
Und schließlich ist auf eine ausgedehnte und kritische Diskussion zur Frage des Medienwandels und des Umgangs mit den Hassbotschaften verbreitenden „sozialen Medien“ hinzuweisen, dabei wurden die Strukturen, Prozesse und Funktionen des öffentlichen Raumes reflektiert und auf die Verantwortung der Nutzer verwiesen (u.a. Jakobsen, 2013; Lippestad, S. 212ff.).
8. Würdigung des Prozesses
Im Verlaufe des Prozesses musste der Angeklagte nicht überführt werden, da er zu allen Punkten geständig war, beim ersten Verhör hatte er der Vernehmerin gesagt: „Sie haben also die bedauernswerte Aufgabe und die Ehre, das größte Monster der norwegischen Geschichte seit Vidkun Quisling zu verhören“ (zit. nach Seierstad, 2013). Insofern ist auch mit einer gewissen Berechtigung gefragt worden, warum das Gericht einen doch erheblichen Aufwand betrieben hatte. Wenn man die Frage um eine gesellschaftliche Dimension, ja um eine existentielle erweitert, wird das Besondere an diesem Prozess deutlich: Allen Verantwortlichen in der Justiz, in der Politik, in der Öffentlichkeit, auch überwiegend der medialen, war bewusst, dass die Einmaligkeit der Terrortat und die traumatischen Folgen für die Opfer, für die Hinterbliebenen, für die Gesellschaft als Ganze einer besonders sorgfältigen Aufarbeitung bedurfte (vgl. Bugge, 2015). Das Attentat war ein öffentliches, es betraf die ganze Nation und rechtfertigte schon deshalb größtmögliche Transparenz. Insofern auch war der Prozess ein Versuch, den gesellschaftlichen Frieden wiederherzustellen, den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, den Beteiligten und Hinterbliebenen die Anerkennung ihres Leids zu demonstrieren und ihnen bei der Trauma-Bearbeitung – soweit ein Gericht das kann – zu helfen. Indem das Gericht den Attentäter für zurechnungsfähig erklärte, hat es in dieser Hinsicht außerordentlich klug und vorausschauend geurteilt, dabei im Rahmen der Rechtsnormen argumentiert – die Widersprüchlichkeiten der gutachterlichen Aussagen haben das nicht erleichtert. Die Staatsanwälte, die auf das Gegenteil plädiert hatten, aber auf eine Revision verzichteten, sind der richterlichen Klugheit gefolgt – sie haben bedacht unterschieden zwischen Recht haben und Recht bekommen: Man mag sich nicht ausmalen, was den Opfern im Besonderen und der Gesellschaft im Allgemeinen zugemutet worden wäre, wenn es eine Fortsetzung des Prozesses und/oder eine Neuauflage gegeben hätte.
Im Gegensatz zum Münchner NSU-Prozess, der ein Jahr später begann und vier Jahre dauerte, wurde in Oslo eine breite Öffentlichkeit hergestellt. Nach Presseberichten hat der Präsident des verhandelnden Oberlandesgerichts auf die Frage, ob man sich denn mit den Kollegen in Oslo, die für den Breivik-Prozess zuständig waren, beraten habe, erklärt, man führe schließlich einen Prozess nach deutschen Regeln. Das rechtspositivistische Beharren sollte den Prozess revisionssicher machen, sah aber im Ergebnis ab von den Verletzungen der Opfer und der Hinterbliebenen. Stellt man den Münchner Prozess neben den Osloer, so ist seit der Urteilsverkündung in Oslo die Diskussion über den Prozess zu Ende; soweit dies möglich ist, ist in Norwegen Rechtsfrieden eingekehrt (damit ist nichts geurteilt über individuelle und gesellschaftliche Trauma-Verarbeitung). Der Münchner Prozess hingegen hat weder den Sachverhalt gänzlich aufgeklärt, noch einen Beitrag zum Rechtsfrieden geleistet, wie das Fazit im Jahre 2021 lautet: „Der NSU-Prozess ist mittlerweile zur Chiffre geworden für den Zustand Deutschlands, für all die Versäumnisse im Kampf gegen rechts und den mühsamen Versuch, mit den Mitteln des Rechtsstaats die jüngste Geschichte des Landes aufzuarbeiten“ (Ramelsberger, 2021). Bei aller Kritik, die es auch gab, wird man konstatieren können, dass das Osloer Prozessgeschehen dazu beigetragen hat, dass der Rechtsfrieden in Norwegen wiederhergestellt wurde; die Osloer Richter, die Staatsanwälte und Verteidiger haben der Rechtspflege und der norwegischen Gesellschaft einen Dienst erwiesen.
Man kann den – was makaber klingen mag – gesellschaftlich glücklichen Ausgang des Prozesses ganz wesentlich damit erklären, dass Öffentlichkeit nicht nur formal hergestellt, die Opfer und Hinterbliebenen einbezogen wurden – Öffentlichkeit war ein ganz wesentliches Prinzip der Prozessführung, sie war gewünscht, die norwegische Prozessordnung hat dies begünstigt: 110 Plätze standen den Journalisten zu, weitere in Nebenräumen, es wurde simultan gedolmetscht; der Prozess wurde vom ersten bis zum letzten Tag von der Weltpresse, von den Opfern und den Hinterbliebenen beobachtet. Auch in Oslo war der Gerichtssaal viel zu klein, es wurde daher in andere Räume übertragen. Vor allem aber: Das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat den Prozess gezeigt. Jedermann konnte sich ein Bild machen; nationsweit, ja in der ganzen Welt konnte man den Prozess auf dem Bildschirm verfolgen, bis heute sind viele Passagen des Prozesses im Netz abrufbar. (Vom Münchner NSU-Prozess gibt es keine offiziellen Dokumentationen oder Protokolle, das Gericht verzichtete ganz bewusst darauf, trotz wiederholter Einlassungen der Verteidiger; nur die Aufzeichnungen und Veröffentlichungen von Journalistinnen und Journalisten liegen vor (Ramelsberger, 2021)). Die Entscheidung für Transparenz hat auch mit der Größe des Landes und der Unvorstellbarkeit der Tat zu tun: Auf Utøya war die Nachfolgegeneration der Arbeiterpartei versammelt, aus dem ganzen Land waren Mitglieder auf der Insel, kaum eine Parteigliederung, die nicht betroffen war – vom Süden des Landes bis über 2.000 Kilometer entfernt im Norden, auf Svalbard, woher das jüngste Opfer gekommen war, der 14 jährige Johannes Buø, er war seit einem halben Jahr Mitglied der Parteijugend gewesen (Solvoll, Malmø, 2011). Den überlebenden Opfern und den Hinterbliebenen sollte eine Chance des Dabeiseins gegeben werden und also auch eine Chance für die Trauma-Bewältigung. Nur mit Rücksicht auf die Verletzung von Persönlichkeitsrechten, bei der Beweisaufnahme zu Tod oder körperlichen Schäden oder bei Breiviks monologisierenden Indoktrinationsversuchen wurden die Kameras abgeschaltet; auch im schriftlichen Urteil sind solche Passagen, an denen die physischen Beschädigungen genannt werden, geschwärzt. Viele Opfer bestanden aber gerade darauf, bei der Verlesung der sie betreffenden Ermittlungsprotokolle im Gerichtssaal anwesend zu sein, die Möglichkeit wurde ihnen eingeräumt.
Die Verfahrenspraxis war durch die norwegische Kultur des Öffentlichkeitsprinzips und durch die norwegische Prozessordnung vorgegeben und nicht ungewöhnlich. Es ist in der öffentlichen Bewertung aber auch darauf hingewiesen worden, dass die juristisch korrekte (gegenüber Breivik) und zugleich sensible (gegenüber den Zeugen und Opfern) Prozessführung in Oslo, die den Rechtsfrieden wiederherstellte, nicht zum mindesten der Tatsache geschuldet war, dass dem Gericht Frauen vorsaßen und die Anklagebehörde von einer Frau geleitet wurde. Ein Vergleich liegt nahe mit dem im Dezember 2020 abgeschlossenen Prozess gegen den Attentäter auf die Synagoge von Halle; vieles ähnelt dem Prozess in Oslo: Es war die Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht Naumburg, die den Angeklagten in die Schranken verwies, es waren die Nebenkläger und die traumatisierten Opfer mit ihren Aussagen, die zivilen Widerstand gegen Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit und Fremdenhass zum Ausdruck brachten und insofern den Angeklagten mit seinen Hasstiraden auflaufen ließen (Jaeger, 2020).
Gewiss, es hat auch in Norwegen eine heftige Debatte, insbesondere eine presseethische, darüber gegeben, ob das Gericht und die Medien sich mit der Entscheidung für Transparenz zu Erfüllungsgehilfen des Attentäters machen würden. Der Publikation seines Pamphlets, die Vorführung seines Propagandavideos in voller Länge, aber auch die Befragung des Angeklagten, die öffentliche Einvernahme der Gutachter und der Zeugen wurde mit Kritik an einer nichtzulässigen Täterzentrierung begegnet. Das Gericht hat im Verlauf des Prozesses die Selbstinszenierung Breiviks begrenzt, die öffentlichen Übertragungen wurden gekürzt. Es war auffallend, dass bei der medialen Bewachung die Berichterstattung sich verschob, von den Aussagen Breiviks hin zu den investigativen Fragen der Staatsanwältin Inga Bejer Engh, mit denen es ihr gelang, den Angeklagten als Blender zu entlarven. Insofern zeigten sich die Medien, nicht zuletzt auch die Boulevardzeitungen, ihrer Verantwortung bewusst: Eine dieser Boulevardzeitungen versah die jeweilige Online-Berichterstattung mit einem „Anti-Breivik-Button“ – die Leserschaft konnte so Berichte zum Prozess ausblenden. Der nationale Gemeinschaftssinn, der sich im unmittelbaren Zusammenhang der Tat und während des ganzen Prozesses offenbarte, begleitet von reflektiertem Journalismus, hat konstruktiv gewirkt; die Gesellschaft hat sich als immun erwiesen gegenüber der Breivik’schen Ideologie (Kahr, 2012); Jens Breivik, der Vater, hat dies trefflich formuliert (siehe das Eingangszitat).
Das Gericht hat in einer gesellschaftlichen, ja nationalen Krisensituation in vorbildlicher Weise die Funktion angenommen, die es in einer demokratischen Gesellschaft haben soll: Repräsentant eben dieser Gesellschaft zu sein, Recht zu sprechen, aber auch konkret auszudrücken, was diese Gesellschaft zusammenhält. Nach allem was man erfährt, haben die Hinterbliebenen, hat die Mehrheit der Gesellschaft sowohl das Prozessgeschehen als auch das Urteil akzeptiert und als Akt der Krisenbewältigung verstanden. Das weit verbreitete Gefühl, endlich eine bedrängende Situation überstanden zu haben, steht nicht im Widerspruch dazu. Die Gesellschaft und das Gericht als Teil derselben haben die Fähigkeit zu trauern gezeigt.
9. Quellen und Literatur (Auswahl)
Oslo Tingrett, 24.08.2012, Saksnr. 11–188627MED-OTIR/05 [15.10.2012] (Urteil).
Aderet, Ofer: Pioneer of global peace studies hints at link between Norway massacre and Mossad. In: Haaretz, 30.04.2012 https://www.haaretz.com/1.5218261 [22.02.2021].
Berntsen, Ida u.a. (Hgg.): 22 / 07 / 11. Fra hat til kjærlighet. Hendelsene som forandret Norge, Oslo 2011.
Borchgrevink, Aage Storm: En norsk tragedie. Anders Behring Breivik og veiene til Utøya (engl.: A Norwegian tragedy. Anders Behring Breivik and the massacre on Utøya), Oslo 2012.
Borchgrevink, Aage Storm: Woher kam der Hass? Die Bildung eines norwegischen Terroristen. In: Decker, Frank, Bernd Henningsen, Kjetil Jakobsen (Hgg.): Rechtspopulismus und Rechtsextremismus in Europa. Die Herausforderungen der Zivilgesellschaft durch alte Ideologie und neue Medien, Baden-Baden 2015, S. 165–185.
Breivik, Anders Behrens: 2083. A European declaration of independence, 3 Bde. London 2011.
Breivik-Archiv:
https://sites.google.com/site/dasbreivikarchiv/2083 [18.09.2020]. Auf dieser Seite sind in deutscher Übersetzung das „Manifest“ 2083 und zentrale Dokumente des Prozesses gespeichert – einige gesperrt.
Breivik, Jens: Min skyld? En fars historie, Oslo 2014.
Bugge, Renate: Eine Nation und eine Organisation in der Krise. Norwegen und die Arbeiterpartei nach dem Terroranschlag vom 22. Juli 2011, in: Decker, Frank, Bernd Henningsen, Kjetil Jakobsen (Hgg.): Rechtspopulismus und Rechtsextremismus in Europa. Die Herausforderungen der Zivilgesellschaft durch alte Ideologie und neue Medien, Baden-Baden 2015, S. 333–339.
Chaitin, Julia: An open letter to Johan Galtung, in: Haaretz, 08.05.2012, einzusehen unter: https://www.haaretz.com/opinion/an-open-letter-to-johan-galtung‑1.5220504?v=1613985466605&mid3850=open [22.02.2021].
Der Standard (o.V.): Zehntausende singen Lied gegen Breivik, 26.04.2012, einzusehen unter: http://derstandard.at/1334796319279/Zehntausende-singen-Lied-gegen-Breivik [11.02.2017]; https://www.youtube.com/watch?v=eRyLasigBBs&index=1&list=RDeRyLasigBBs [11.02.2017].
Enerstvedt, Regi Theodor: Massemorderen som kom inn fra ingenting, Oslo 2012.
Euronews (o.V.): Mahnmal für Terroropfer bei Utøya: Anwohner fürchten, zu sehr an den Anschlag erinnert zu werden, 15.01.2021, einzusehen unter: https://de.euronews.com/2021/01/14/mahnmal-fur-terroropfer-bei-ut-ya-anwohner-furchten-zu-sehr-an-den-anschlag-erinnert-zu-we [05.04.2021].
Færseth, Johan: Galtung leker med ilden. Om Johan Galtungs ferd inn i konspirasjonsteorienes land, in Humanist (4/2011), einzusehen unter: http://arkiv.humanist.no/galtung2.html [21.02.2021].
Fritanke (o.V.): Et intellektuelt og moralsk selvmord, 24.04.2012, einzusehen unter: https://politiken.dk/kultur/art8098006/%C2%BBDanmark-er-en-nerv%C3%B8st-hysterisk-spiseforstyrret-12-tals-posterboy%C2%AB [21.02.2021].
Galtung, Johan: Ti teser om 22. juli, in: Morgenbladet, 07.10.2011, einzusehen unter: https://morgenbladet.no/samfunn/2011/ti_teser_om_22_juli [21.02.2021].
Galtung, Johan: Om klare linjer og tvisyn. In: Humanist (1/2012), einzusehen unter: http://arkiv.humanist.no/galtung.html [21.02.2021].
General-Anzeiger: Film setzt Opfern von Breivik-Massaker ein Denkmal, 19.02.2018, einzusehen unter: https://ga.de/freizeit/kino/film-setzt-opfern-von-breivik-massaker-ein-denkmal_aid-43901961 [05.04.2021].
Göttinger Tageblatt: Terrorismus Mahnmal zu Anschlägen in Norwegen enthüllt, 29.09.2019, einzusehen unter: https://www.goettinger-tageblatt.de/Nachrichten/Panorama/Mahnmal-zu-Anschlaegen-von-Oslo-und-Utoeya-in-Norwegen-enthuellt [05.04.2021].
Henningsen, Bernd: Wenn der König weint. Die norwegische Tragödie trifft ganz Skandinavien, in: Süddeutsche Zeitung, 27.07.2011, S. 2, einzusehen unter: https://www.sueddeutsche.de/politik/norwegen-und-der-umgang-mit-rechtspopulismus-freiheit-verpflichtet‑1.1125099 [23.08.2020].
Henningsen, Bernd: Geheimnis der Demokratie, in: Der Tagesspiegel, 13.05.2013, einzusehen unter: https://www.tagesspiegel.de/kultur/geheimnis-der-demokratie/8199034-all.html [24.08.2020].
Jaeger, Mona: Die Richterin und der Hasser, in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 08.11.2020, S. 8, einzusehen unter: https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/die-richterin-im-prozess-gegen-den-attentaeter-von-halle-17039459.html [20.02.2021].
Jakobsen, Kjetil: Die dunkle Seite der Zivilgesellschaft. Norwegische Erfahrungen mit Medienwandel und Rechtsextremismus, in: Eichert, Christof, Roland Löffler (Hgg.): Die Bürger und ihr Staat. Ein Verhältnis am Wendepunkt? Freiburg 2012, S. 74–81.
Jakobsen, Kjetil: Aufstand der Bildungsverlierer? Die Fortschrittspartei auf dem norwegischen Sonderweg. In: Decker, Frank, Bernd Henningsen, Kjetil Jakobsen (Hgg.): Rechtspopulismus und Rechtsextremismus in Europa. Die Herausforderungen der Zivilgesellschaft durch alte Ideologie und neue Medien, Baden-Baden 2015, S. 147–164.
Johansen, Raymond: Mehr Offenheit, mehr Demokratie, in: Decker, Frank, Bernd Henningsen, Kjetil Jakobsen (Hgg.): Rechtspopulismus und Rechtsextremismus in Europa. Die Herausforderungen der Zivilgesellschaft durch alte Ideologie und neue Medien, Baden-Baden 2015, S. 37–43.
Kahr, Robert: Der mediale Umgang mit dem Breivik-Prozess, einzusehen unter: https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/142949/der-mediale-umgang-mit-dem-breivik-prozess-24–08-2012 [18.09.2020].
Leggewie, Claus: Anti-Europäer. Breivik, Dugin, al-Suri & Co, Berlin 2016.
Lippestad, Geir: Det vi kan stå for. Oslo 2013 (dt.: Ich verteidigte Anders Breivik. Warum? Meine schwierige Strafverteidigung, Freiburg 2015).
Moen, Jo Stein, Trond Giske: Utøya. En biografi, Oslo 2012.
Musharbash, Yassin, Holger Stark: Der einsame Wolf und sein digitales Rudel, in: Die Zeit, 23.03.2019, einzusehen unter:https://www.zeit.de/politik/ausland/2019–03/tarrant-und-die-rechtsextreme-szene/komplettansicht [17.09.2020].
NOU 2012:14. Rapport fra 22.juli-kommisjonen, Oslo 2012.
NRK (o.V.): 22.07, Terroren som rammet Norge. 22. Juli retssaken: retsaktørene, einzusehen unter: https://www.nrk.no/227/fakta/rettsaktorene/ [20.09.2020].
NRK (o.V.): 17.09.2013, Frp tok selvkritikk og kritiserte, einzusehen unter: https://www.nrk.no/valg/2013/frp-tok-selvkritikk-og-kritiserte‑1.11246574 [09.10.2020].
NRK (o.V.): 16.09.2020, Terrordømte Anders Behring Breivik ønsker å bli prøveløslatt, einzusehen unter: https://www.nrk.no/norge/terrordomte-anders-behring-breivik-onsker-a-bli-proveloslatt‑1.15163030 [09.10.2020].
Nyfløt, Hilda: Verdenskjent, norsk professor mener man må forske på jødemakt, in: Dagbladet, 25.04.2012, einzusehen unter: https://www.dagbladet.no/nyheter/verdenskjent-norsk-professor-mener-man-ma-forske-pa-jodemakt/63317865 [21.02.2021].
Olsen, Asbjørn: Breivik var skadet allerede som toåring. Moren til Anders Behring Breivik mente han var ond og ute etter ødelegge henne, in: tv2, 16.03.2016, einzusehen unter: https://www.tv2.no/a/8142855/ [20.09.2020].
Ramelsberger, Annette: Ein deutsches Anti-Helden-Epos, in: Süddeutsche Zeitung, 18.02.2021, einzusehen unter: https://www.sueddeutsche.de/medien/saal-101-nsu-prozess-hoerspiel‑1.5208907 [19.92.2021].
o.V.: Rettspsykiatrisk erklæring 1, 2011, einzusehen unter: https://www.vg.no/spesial/2011/22-juli/psykiatrisk_vurdering/ [21.09.2020].
o.V.: Rettspsykiatrisk erklæring 2, 2012, einzusehen unter: https://www.vg.no/spesial/2011/22-juli/psykiatrisk_vurdering/ [21.09.2020].
Seierstad, Åsne: En av oss. En fortelling om Norme, Oslo 2013 (dt.: Einer von uns: Die Geschichte des Massenmörders Anders Breivik, Zürich 2016).
Søderlind, Didrik: Noen ord om Johan Galtung, in: Humanist (26.04.2012), einzusehen unter: http://arkiv.humanist.no/galtung4.html [21.02.2021].
Solvoll, Einar, Morten Malmø: Tragedien som samlet Norge. 22.07.2011: Da terroren rammet Oslo og AUFs sommerleir på Utøya. Dokumentar, Oslo 2011.
Spiegel (o.V.): Breivik baute zweite tonnenschwere Bombe, 17.08.2011, einzusehen unter: https://www.spiegel.de/panorama/justiz/attentaeter-von-norwegen-breivik-baute-zweite-tonnenschwere-bombe-a-780873.html [20.09.2020].
Spiegel (o.V.): Als der Terror nach Utøya kam, 09.10.2018, einzusehen unter: https://www.spiegel.de/kultur/kino/22-juli-auf-netflix-als-der-terror-nach-utoya-kam-a-1230966.html [05.04.2021].
Stormark, Kjetil: Da terroren rammet Norge. 189 minutter som rystet verden, Oslo 2011.
Süddeutsche Zeitung (o.V.): „Ich hätte gerufen: Erschieß mich zuerst!“, 30.06.2015, einzusehen unter: https://sz-magazin.sueddeutsche.de/familie/ich-haette-gerufen-erschiess-mich-zuerst-81386 [24.08.2020].
Süddeutsche Zeitung (o.V.): Utøya: Anwohner klagen gegen Utøya-Denkmal, 02.06.2016, einzusehen unter: https://www.sueddeutsche.de/panorama/ut-ya-die-wunde-der-erinnerung‑1.3016791 [05.04.2021].
Tandstad, Brent: Sammenligner Støre med Breivik, in: NRK, 19.01.2012, einzusehen unter: https://www.nrk.no/norge/sammenligner-store-med-breivik‑1.7959418 [21.02.2021].
Verdens Gang (o.V.), 20.08.2011, Slik ble han massemorderens forsvarer, einzusehen unter: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/k2QVa/slik-ble-han-massemorderens-forsvarer [09.10.2020].
Zondag, Martin H.: Dette er ganske vill lesing fra Galtung, in: NRK, 24.04.2012, einzusehen unter: https://www.nrk.no/norge/_‑en-trist-sorti-for-galtung‑1.8098250 [21.02.2021].
Bernd Henningsen
April 2021
Bernd Henningsen, Studium der Politischen Wissenschaft, Nordischen Philologie, Philosophie und Psychologie in München; 1992–2002 Professor für Skandinavistik/Kulturwissenschaft und (Gründungs-) Direktor des Nordeuropa-Instituts an der Humboldt-Universität zu Berlin; 2002 Professor für Politikwissenschaft, Kultur und Politik Nordeuropas und der Ostseeregion an der Universität Greifswald; Gast- bzw. Honorarprofessor in Stockholm, in Örebro, in Kopenhagen. Seit 2005 wieder an der Humboldt-Universität; seit 2010 pensioniert und Honorarprofessor am Nordeuropa-Institut. Zahlreiche Veröffentlichungen zur Politik und Kultur Nordeuropas.
Zitierempfehlung:
Henningsen, Bernd: „Der Prozess gegen Anders Behring Breivik, Norwegen 2012“, in: Groenewold/ Ignor / Koch (Hrsg.), Lexikon der Politischen Strafprozesse, https://www.lexikon-der-politischen-strafprozesse.de/glossar/breivik-anders-behring/, letzter Zugriff am TT.MM.JJJJ.
Abbildungen
Verfasser und Herausgeber danken den Rechteinhabern für die freundliche Überlassung der Abbildungen. Rechteinhaber, die wir nicht haben ausfindig machen können, mögen sich bitte bei den Herausgebern melden.
© nrkbeta, Oslo after the terror (5977180081), veränderte Größe von https://www.lexikon-der-politischen-strafprozesse.de, CC BY-SA 2.0
© Bjørn Heidenstrøm from Sætre, Norway, Oslo on 27.7.2011 ‑osloexpl ‑utoya ‑norway ‑photo (5981997926), veränderte Größe von https://www.lexikon-der-politischen-strafprozesse.de, CC BY 2.0
© Wolfmann, Terrorist Anders Behring Breivik’s fake police ID as evidence item on display at 22. juli-senteret (22 July Information Center) in Regjeringskvartalet, Oslo, Norway. Photo 2018-09-14, veränderte Größe von https://www.lexikon-der-politischen-strafprozesse.de, CC BY-SA 4.0